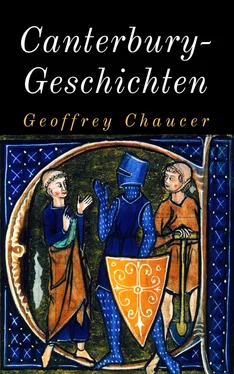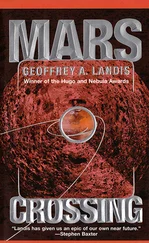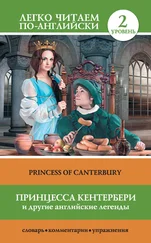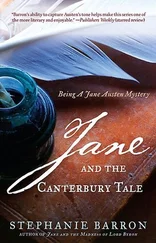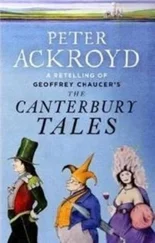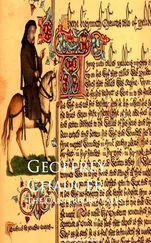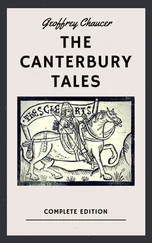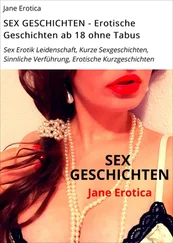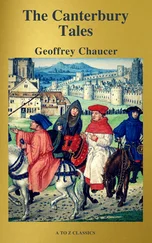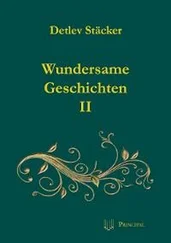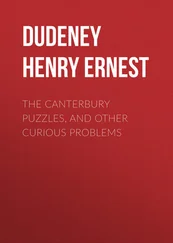Wie viel die Anmerkungen diesem fleißigen und verständigen Erklärer verdanken, wird jedem Kenner ohne weiteres klar sein. Das Verdienst des Mannes, der vor hundert Jahren an das schwierige Werk der Textesläuterung ging, ohne sich auf eine nennenswerte Vorarbeit stützen zu können, sollte ihm nicht in der Weise geschmälert werden, wie es von Wright (Anecd. Liter. 5.23, und wiederholt in seiner Ausgabe, S. XXXIV) geschehen ist. Bei aller Anerkennung der großen Verdienste, welche der letztgenannte Gelehrte für die Förderung der angelsächsischen sowohl, wie der altenglischen Literatur sich erworben hat, lässt sich doch der Wunsch nicht unterdrücken, dass seine Ausgabe der Canterbury-Tales dieselben Fortschritte der Tyrwhittschen gegenüber gemacht haben möchte, wie Tyrwhitt gegen seinen nächsten Vorgänger Urry (1729). Aber wenn es wahr sein mag, dass man bei Tyrwhitt nur wenige Verse liest, wie Chaucer sie selbst geschrieben hat (Wright a. a. O.), so ist es sicher ebenso wahr, dass man bei Wright ein gutes Drittel der Verse überhaupt gar nicht lesen kann. Hätte Wright den Cod. Harlejanus nur genau und ohne alle Änderung abdrucken lassen, so hätte man wenigstens in seiner Ausgabe eine sichere handschriftliche Basis. Aber leider sagt er (S. XXXVI), dass er da Änderungen gemacht habe, wo sie »absolut notwendig gewesen seien«. Aber ein Blick auf jede beliebige Seite des Buches lehrt, dass dies nicht wahr ist – und so verliert die Ausgabe selbst den bescheidenen Werth eines korrekten Textabdruckes.
Über meine Vorgänger auf dem Gebiet der Übersetzung kommt mir nur ein bedingtes Urteil zu. Kannegießer hat eine Auswahl aus den Canterbury-Geschichten in der Zwickauer Taschenbibliothek auswärtiger Klassiker veröffentlicht (2 Bdchen. 1827). Fiedlers Übersetzung (Dessau 1844) bricht bei Vers 5560 ab. Ue
Übertragungsproben von Fr. Jacob, die in einigen Lübecker Programmen erschienen sein sollen, sind mir nicht zu Gesicht gekommen. Wie Wright von Tyrwhitt, so behauptet Fiedler von Kannegießer, dass er sehr wenig vom Altenglischen verstanden habe. Fruchtbarer als solche allgemeinen Beschuldigungen wäre es immer noch bei dem jetzigen Stande dieser Studien, wenn Jeder von seinem Vorarbeiter so viel als möglich zu lernen suchte, sei es durch Aneignung seiner Resultate, oder durch Widerlegung seiner Irrtümer. In diesem Sinne habe ich sowohl Wright als Fiedler für Einleitung und Anmerkungen benutzt, natürlich mit steter Angabe meiner Quelle. Von den Übersetzungen meiner Vorgänger ähnlichen Gebrauch zu machen, fühlte ich mich nicht versucht, wenn ich mich überhaupt dazu berechtigt gehalten hätte. Eine poetische Übersetzung, wenn auch nur eine Kopie, soll doch ein Kunstwerk und somit aus einem Guss und Geist geschaffen sein. Fremde Federn, wenn auch noch so bunt, passen nicht zu den meinen.
Hertzberg.
Einleitung.
Geoffrey Chaucers Zeitalter, Leben und schriftstellerischer Charakter.
Geoffrey Chaucer gehört mit seiner ganzen Lebenszeit demjenigen Jahrhundert an, in welchem auf den britischen Inseln die Verschmelzung des niederdeutschen (angelsächsischen) Volkselementes einerseits und des französisch-normannischen anderseits für immer vollzogen wurde; wodurch die Engländer als eine nach innen einige, nach außen geschlossene Nation in die europäische Völkerfamilie eintraten. Chaucer selbst hat bei diesem Vorgang von welthistorischer Bedeutung entscheidend mitgewirkt, ja er hat recht eigentlich durch seine literarische und dichterische Wirksamkeit demselben das Siegel der Vollendung aufgedrückt; er hat den nächsten Jahrhunderten einen Schatz von Dichtungen hinterlassen, deren Ausdrucksweise unbestritten als mustergültig betrachtet wurde; er hat einen Einigungspunkt in das Chaos schwankender Idiome gebracht, er hat die Sprache und mit der Sprache die Nationalität selbst fixiert. Die Umwandlungen, welche das Englische seit seiner Zeit und bis zu Shakespeare erlitten hat, sind zwar nicht unbedeutend gewesen, sie haben sich aber durchaus innerhalb der Demarkationspunkte bewegt, die wir bereits von Chaucer abgesteckt finden; sie sind nur eine Weiterbildung der sprachschöpferischen Prinzipien, welche der große Dichter mit richtigem Instinkt und feinem Ohr dem dunkeln Stimmengewirr der werdenden Volksdialekte abgelauscht hatte. Darum darf noch nach zwei Jahrhunderten Spenser, der ältere Zeitgenosse des großen britischen Dramatikers, auf Chaucer als auf den » reinen Born des ungetrübten Englisch« hinweisen.
Schon vor der Normanneneroberung hatte das Angelsächsische allmählich jene vollen und wohlklingenden Formen eingebüßt, die allen deutschen Dialekten ursprünglich eigen sind. Die Abstumpfung und Abschwächung der Vokale in den Endungen, welche die Aussprache unseres jetzigen Deutsch dem Ausländer so unerquicklich erscheinen lässt, war in England noch um ein Jahrhundert früher eingetreten als bei uns. Die Sprache der sogenannten Sachsenchronik des 11. Jahrhunderts ist bereits ein Plattdeutsch, das sich im Klange wenig von dem unserer norddeutschen Niederungen unterschieden haben kann. Die Auslösung und Verschlechterung der Sprache wurde durch die Gewaltherrschaft der Dänen im 11. und 12. Jahrhundert noch beschleunigt. Denn mit ihr ging die Volksbildung wieder zu Grunde, die zwei Jahrhunderte früher durch des großen Königs Alfred Bemühungen einen so herrlichen Aufschwung genommen hatte. Von eigentlichen literarischen Erzeugnissen war um diese Zeit so gut wie gar nicht mehr die Rede. Sie verschwanden vollständig, seitdem die Schlacht bei Hastings die Herrschaft der französischen Normannen über England entschieden hatte.
Die französische Sprache ward jetzt die offizielle Sprache der Reichsversammlung, der Gerichte, der Schulen. Sie wurde nicht nur am Königshof, sondern an allen jenen großen und kleinen Edelsitzen gesprochen und gesungen, die durch das Feudalsystem des Eroberers über das ganze Land ausgestreut waren. Die französischen Normannen hatten zudem eine im Aufblühen begriffene ritterliche Poesie auf die Insel mitgebracht, und gerade durch den kräftigen Anstoß, den jene große Waffenthat dem Geiste des erobernden Volkes gegeben, entfaltete sich diese Poesie rasch und in reicher Fülle. So sehen wir denn die wunderbare Erscheinung, die ohne Parallele in der Weltgeschichte dasteht: in einem Lande, dessen Bevölkerung wesentlich und ursprünglich deutsch ist, blüht und herrscht die französische Literatur zwei Jahrhunderte lang in einer Ausschließlichkeit, die fast keine andere literarische Lebensregung neben sich aufkommen lässt. Ja, was noch mehr und wunderbarer ist: es sind nicht etwa in Frankreich entstandene und gedichtete Lieder, die an den Höfen der nach England übergesiedelten Familien nachgesungen und nacherzählt werden: vielmehr ist gerade der Grund und Boden der deutschen Insel der Hauptsitz und Entstehungsort der bedeutendsten dichterischen Erzeugnisse der altfranzösischen Literatur.
Dieses Verhältnis wurde, je länger es dauerte, desto unnatürlicher, zumal der unterworfene deutsche Stamm eine so große innere Lebenskraft bewahrte und weiter entwickelte, dass er selbst die feudalen Institutionen des französischen Rittertums überwand und den urdeutschen Rechtsverhältnissen sich anzupassen und unterzuordnen zwang.
Es war nicht anzunehmen, dass der Deutsche jemals seine Sprache für die französische aufgeben würde. Der unumgängliche Ideenaustausch zwischen den beiden Völkern musste daher zu einem eigentümlichen Kompromiss führen, der anfangs auf eine ziemlich rohe und unbewusste, aber doch wirksame Weise vollzogen wurde. Die Notwendigkeit, sich gegenseitig, wenigstens in den materiellsten und handgreiflichsten Beziehungen, zu verständigen, führte zur Verstümmelung sowohl der deutschen als französischen Wortformen. Es war genug, dass man sich die Wortstämme merkte. Die feineren Verhältnisse der Deklination und Konjugation, schon ohnehin durch tonlose Silben bezeichnet, waren dabei unnütz, ja sogar hinderlich. Sie wurden bis auf den notdürftigsten Rest abgestoßen. Gewisse Eigentümlichkeiten der französischen Aussprache, gegen die sich das niederdeutsche Organ sträubte, namentlich die Nasaltöne, ließ man teils fallen, teils suchte man ihnen durch andere Kombinationen so nahe zu kommen, als es eben ging. Man sprach sie, wie man sie zu hören glaubte.
Читать дальше