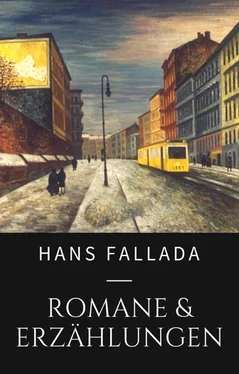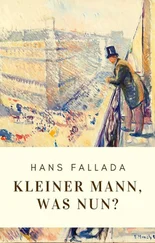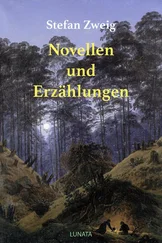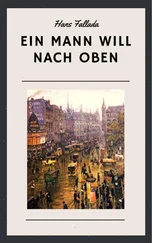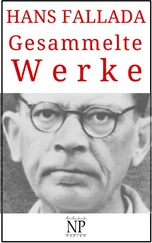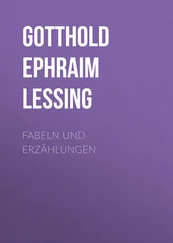Hans Fallada - Hans Fallada - Romane und Erzählungen
Здесь есть возможность читать онлайн «Hans Fallada - Hans Fallada - Romane und Erzählungen» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Hans Fallada - Romane und Erzählungen
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Hans Fallada - Romane und Erzählungen: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Hans Fallada - Romane und Erzählungen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Jeder stirbt sich allein
Kleiner Mann, was nun?
Wer einmal aus dem Blechnapf frißt
Ein Mann will nach oben
Der Trinker
Wir hatten mal ein Kind
Bauern, Bonzen und Bomben
Wolf unter Wölfen
Der junge Goedeschal
Der eiserne Gustav
Kleiner Mann, großer Mann
Der junge Herr von Strammin
Der Alpdruck
Anton und Gerda
Im Blinzeln der großen Katze
Hans Fallada - Romane und Erzählungen — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Hans Fallada - Romane und Erzählungen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Anna Quangel hatte nun längst ihren stillen Zuhörerposten aufgegeben, sie saß lebhaft da im Sofa, sprach mit, schlug Themen vor und dachte Sätze aus. Sie arbeiteten in der schönsten Gemeinsamkeit, und diese tiefe, innere Gemeinsamkeit, die sie nach so langer Ehe jetzt erst kennenlernten, wurde ihnen zu einem großen Glück, das über die ganze Woche hin sein Licht ausstrahlte. Sie sahen sich mit einem Blick an, sie lächelten, jedes wußte von dem andern, es hatte jetzt an die nächste Karte gedacht oder an die Wirkung dieser Karten, an die ständig wachsende Zahl ihrer Anhänger, und daß schon mit Begier auf die nächste Nachricht von ihnen gewartet wurde.
Beide Quangels zweifelten nicht einen Augenblick daran, daß ihre Karten jetzt in den Betrieben heimlich von Hand zu Hand gingen, daß Berlin von diesen Bekämpfern zu sprechen anfing. Sie waren sich klar darüber, daß ein Teil der Karten der Polizei in die Hände fiel, aber sie nahmen an: höchstens jede fünfte oder sechste Karte. Sie hatten so oft an diese Wirkung gedacht und von ihr gesprochen, daß die Weiterverbreitung ihrer Nachrichten, das Aufsehen, das sie erregten, ihnen ganz selbstverständlich erschien, eine Tatsache, die man nicht bezweifeln konnte.
Dabei hatten beide Quangels nicht den geringsten tatsächlichen Anhaltspunkt dafür. Ob Anna Quangel nun vor einem Lebensmittelladen in der Schlange anstand, ob der Werkmeister sich stumm mit seinen scharfen Augen zu einer Gruppe von Schwätzern stellte und eben nur durch sein Dortstehen ihr Geschwätz zum Aufhören brachte – niemals hörten sie ein Wort von dem neuen Kämpfer gegen den Führer, von den Botschaften, die er in die Welt sandte. Aber dieses Schweigen über ihre Arbeit konnte sie nicht wankend machen in dem festen Glauben, daß doch von ihr geredet wurde, daß sie ihre Wirkung tat. Berlin war eine sehr große Stadt, und die Verteilung der Karten erstreckte sich auf ein weites Gebiet, es brauchte seine Zeit, bis das Wissen von ihnen überall einsickerte. Kurz, den Quangels erging es wie allen Menschen: sie glaubten, was sie hofften.
Von den Vorsichtsmaßregeln, die Quangel zu Beginn seiner Arbeit für nötig gehalten hatte, war er nur bei den Handschuhen abgewichen. Genaue Überlegungen hatten ihm gesagt, daß diese störenden Dinger, die seine Arbeit so verlangsamten, nichts nützten. Seine Karten gingen vermutlich, ehe mal wirklich eine bei der Polizei landete, durch so viele Hände, daß auch der gewiegteste Polizeibeamte nicht mehr ausmachen konnte, was des Schreibers Abdrücke waren. Natürlich beobachtete Quangel weiter die äußerste Vorsicht. Vor dem Schreiben wusch er sich stets die Hände, er faßte die Karten nur sachte und sehr an den Rändern an, und beim Schreiben lag stets ein Löschblatt unter der Schreibhand.
Was das Ablegen der Karten selbst in den großen Bürohäusern anging, so hatte es längst den Reiz der Neuheit verloren. Dieses Ablegen, das ihnen zuerst so gefahrvoll erschienen war, hatte sich mit der Zeit als der leichteste Teil der Aufgabe erwiesen. Man ging in ein solches belebtes Haus, man wartete den richtigen Augenblick ab, und schon stieg man wieder die Treppe hinunter, ein bißchen erleichtert, von einem Druck in der Magengegend befreit, den Gedanken »Wieder einmal gutgegangen« im Kopf, aber nicht sonderlich aufgeregt.
Zuerst hatte Quangel diese Karten allein abgelegt, die Begleitung Annas war ihm sogar unerwünscht erschienen. Aber dann machte es sich von selbst, daß auch dabei Anna tätige Mithelferin wurde. Quangel hielt genau darauf, daß die Karten, ob nun eine oder zwei oder gar drei geschrieben waren, stets am folgenden Tage aus dem Hause kamen. Aber manchmal konnte er wegen seiner von Rheumaschmerzen geplagten Beine schlecht gehen, zum andern forderte die Vorsicht, daß die Karten in weit voneinander entfernten Stadtteilen verbreitet wurden. Das bedingte zeitraubende Bahnfahrten, die an einem Vormittag durch eine Person kaum zu bewältigen waren.
So übernahm Anna Quangel ihren Anteil auch an dieser Arbeit. Zu ihrer Überraschung entdeckte sie, daß es sehr viel aufregender und nervenquälender war, vor einem Hause zu stehen und auf den Mann zu warten, als die Karten selbst abzulegen. Dabei war sie stets die Ruhe selbst. Sobald sie ein derartiges Haus betreten hatte, fühlte sie sich sicher in dem Getriebe der treppan und treppab Steigenden, sie wartete geduldig auf ihre Gelegenheit und legte dann rasch die Karten hin. Sie war sich ganz sicher, daß sie niemals bei diesem Ablegen beobachtet war, daß keiner sich ihrer erinnern und eine Beschreibung ihrer Person geben konnte. In Wahrheit war sie auch viel weniger auffallend als ihr Mann mit dem scharfen Vogelgesicht. Sie war eine kleine Bürgersfrau, die eben mal rasch zum Doktor lief.
Nur ein einziges Mal waren die Quangels bei ihrer sonntäglichen Schreiberei gestört worden. Aber auch bei dieser Störung hatte es nicht die geringste Aufregung und Verwirrung gegeben. Wie viele Male schon besprochen, war Anna Quangel bei dem Klingeln leise an die Flurtür geschlichen und hatte nach den Besuchern Ausschau durch das Guckloch gehalten. Unterdes hatte Otto Quangel das Schreibzeug fortgepackt und die angefangene Karte in ein Buch gelegt. Es standen auch hier erst die Worte: »Führer befiehl, wir folgen! Jawohl, wir folgen, wir sind eine Herde Schafe geworden, die unser Führer auf jede Schlachtbank treiben darf. Wir haben das Denken aufgegeben …«
Die Karte mit diesen Worten hatte Otto Quangel in ein Radiobastelbuch seines gefallenen Sohnes gelegt, und als nun Anna Quangel mit den beiden Besuchern, einem kleinen Buckligen und einer dunklen, langen, müden Frau, eintrat, saß Otto bei seiner Schnitzerei und bosselte an der Büste des Jungen, die schon ziemlich weit vorgeschritten war und auch nach Ansicht Anna Quangels immer ähnlicher wurde. Es erwies sich, daß der kleine Bucklige ein Bruder Annas war; die Geschwister hatten sich fast dreißig Jahre nicht mehr gesehen. Der kleine Buckel hatte stets in Rathenow bei einer optischen Fabrik gearbeitet und war erst vor kurzem nach Berlin geholt worden, um als Spezialist in einer Fabrik zu arbeiten, die irgendwelches Gerät für Unterseeboote herstellte. Die müde, dunkle Frau war Annas noch nie gesehene Schwägerin. Otto Quangel hatte diese beiden Verwandten bisher noch nicht kennengelernt.
An diesem Sonntag wurde es mit der weiteren Schreiberei nichts, die begonnene Karte blieb unvollendet in dem Radiobastelbuch Ottochens liegen. So sehr Quangels auch sonst gegen alle Besuche, gegen Freundschaft und Verwandtschaft eingestellt waren, um der Ruhe willen, in der sie leben wollten, dieser da so unvermutet hereingeschneite Bruder und seine Frau mißfielen ihnen nicht. Heffkes waren in ihrer Art auch stille Leute, irgendeiner religiösen Sekte angehörend, die, nach einer Andeutung zu schließen, von den Nazis verfolgt wurde. Aber sie sprachen kaum davon, wie überhaupt alles Politische ängstlich vermieden wurde.
Aber Quangel hörte staunend, wie die beiden, Anna und ihr Bruder Ulrich Heffke, Kindheitserinnerungen austauschten. Zum ersten Mal hörte er es, daß Anna auch einmal ein Kind gewesen war, ein Kind mit Übermut, Unarten und Streichen. Er hatte seine Frau erst kennengelernt, als sie schon ein älteres Mädchen gewesen war; er hatte nie daran gedacht, daß sie einmal ganz anders ausgesehen hatte, vor ihrem arg geplagten, freudlosen Dienstmädchendasein, das ihr so viel von ihrer Kraft und ihrer Hoffnung genommen hatte.
Nun sah er, während die Geschwister miteinander plauderten, das kleine, arme märkische Dorf vor sich; er hörte, daß sie die Gänse hatte hüten müssen, daß sie sich vor der verhaßten Arbeit des Kartoffelbuddelns stets versteckt und viele Schläge deswegen bekommen hatte, und er erfuhr, daß sie im Dorfe recht beliebt gewesen war, weil sie sich, trotzig und couragiert, gegen alles aufgelehnt hatte, was ihr nach Ungerechtigkeit schmeckte. Hatte sie doch sogar einem ungerechten Schullehrer dreimal hintereinander mit einem Schneeball den Hut vom Kopfe geworfen – und sie war nie als die Täterin entdeckt worden. Nur sie und Ulrich hatten davon gewußt, Ulrich aber petzte nie.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Hans Fallada - Romane und Erzählungen»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Hans Fallada - Romane und Erzählungen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Hans Fallada - Romane und Erzählungen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.