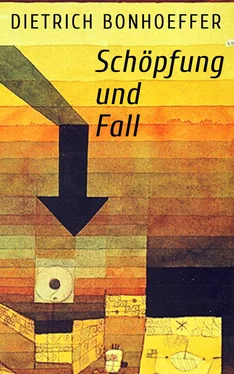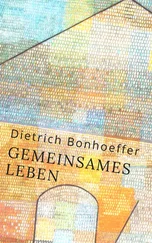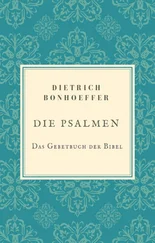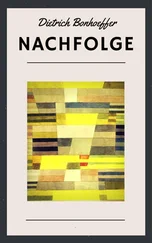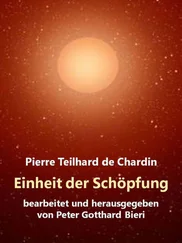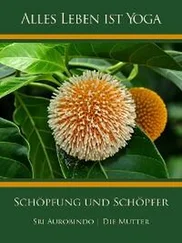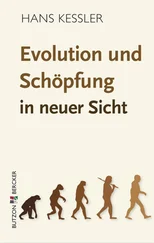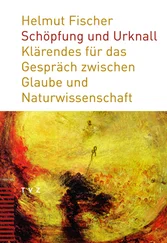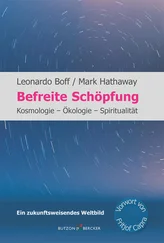Nun könnte der Mensch freilich abermals versuchen, sich aus der ängstenden Mitte herauszustellen und selbst anfänglich zu werden. Er könnte auch dieses Nichts wieder als das die Schöpfung gebärende Etwas zu denken unternehmen. Aber das Nichts hat dort, wo von Schöpfung geredet wird, d. h. theologisch, einen völlig anderen Sinn als dort, wo es in dem anfanglosen Denken als das endlose Ende auftaucht. Das Nichts taucht in unserem philosophierenden Denken dort auf, wo der Anfang nicht gedacht werden kann. Es ist damit letztlich nie etwas anderes als der Grund für Sein. Das Nichts als der Grund für Sein ist als das schöpferische Nichts verstanden, und man müsste nun wieder hinter dieses Nichts zurückfragen, ohne auf den Anfang zu stoßen. Das Nichts des Menschen in der Mitte, der nicht um den Anfang weiß, ist der letzte Erklärungsversuch, ist der Durchgangspunkt für das Seiende. Wir nennen es das erfüllte, geladene, das selbstherrliche Nichts. Das Nichts, das zwischen der Freiheit Gottes und der Schöpfung liegt, ist weder ein Erklärungsversuch für die Schöpfung des Seienden, ist also nicht die Materie, aus der dann in paradoxer Weise die Welt entstünde, der notwendige Durchgangspunkt für das Seiende, es ist überhaupt nicht ein Etwas, auch nicht ein negatives Etwas, es ist diejenige Bestimmung, die allein das Verhältnis der Freiheit Gottes zu seiner Schöpfung auszusagen vermag. Das Nichts ist also auch nicht eine Urmöglichkeit, ein Grund Gottes selbst, es „ist“ überhaupt „Nichts“, es geschieht vielmehr in der Tat Gottes selbst, und es geschieht immer als das schon verneinte, nicht mehr als das geschehende, sondern als das immer schon geschehene Nichts. Wir nennen es das gehorsame, das gottesgewärtige Nichts, das Nichts, das seinen Ruhm und seinen Bestand nicht in sich selbst, auch nicht in seiner Nichtigkeit hat, sondern allein in der Tat Gottes. Also Gott brauchte kein Zwischenglied zwischen sich und der Schöpfung, auch das Nichts ist kein solches „Zwischen“, sondern er bejaht das Nichts nur, sofern er es schon überwunden hat. Das wollten die Alten sagen mit der etwas ungeschickten Umschreibung des Nichts als des nihil negativum (im Unterschied vom nihil privativum , das als Urseiendes verstanden war). Das Nichts hat für die erste Schöpfung nichts Ängstendes, es ist vielmehr selbst der ewige Lobpreis des Schöpfers, der aus Nichts die Welt schuf. Die Welt steht im Nichts, das heißt im Anfang, und das heißt nichts anderes als: Die Welt steht ganz in der Freiheit Gottes. Das Geschöpf gehört dem Schöpfer. Es heißt nun aber auch dies: Der Gott der Schöpfung, des schlechthinnigen Anfangs, ist der Gott der Auferstehung. Die Welt steht von Anfang an im Zeichen der Auferstehung Christi von den Toten. Ja, weil wir um die Auferstehung wissen, darum wissen wir um die Schöpfung Gottes am Anfang, um das Schaffen Gottes aus dem Nichts. Der tote Jesus Christus des Karfreitags – und der auferstandene κύριος [ kyrios ] des Ostersonntags, das ist Schöpfung aus dem Nichts, Schöpfung vom Anfang her. Dass Christus tot war, war nicht die Möglichkeit seines Auferstehens, sondern die Unmöglichkeit, war das Nichts selbst, war das nihil negativum . Es ist schlechterdings kein Übergang, kein Kontinuum zwischen dem toten und dem auferstandenen Christus als die Freiheit Gottes, die am Anfang aus dem Nichts sein Werk schafft. Wenn es möglich wäre, das nihil negativum noch zu verstärken, so müsste hier bei der Auferstehung gesagt werden, es sei mit dem Tode Christi am Kreuz das nihil negativum in Gott selbst hineingenommen – oh große Not, Gott selbst ist tot – aber er, der der Anfang ist, lebt, vernichtet das Nichts und schafft die neue Schöpfung in seiner Auferstehung. Aus seiner Auferstehung wissen wir um die Schöpfung, – denn wäre er nicht auferstanden, so wäre der Schöpfer tot und bezeugte sich nicht; aus seiner Schöpfung aber wissen wir dann wieder um die Kraft seines Auferstehens, weil er der Herr bleibt.
Am Anfang, d. h. aus Freiheit, d. h. aus Nichts schuf Gott Himmel und Erde. Das ist der Trost, mit dem die Bibel uns in der Mitte, uns sich vor dem falschen Nichts, dem anfanglosen Anfang und endlosen Ende Ängstende anredet. Es ist das Evangelium, es ist Christus, der Auferstandene selbst, von dem hier gesagt wird. Dass Gott am Anfang ist und dass er am Ende sein wird, dass er frei ist über die Welt und dass er uns das wissen lässt, das ist Barmherzigkeit, Gnade, Vergebung, Trost.
„Und die Erde war wüst und leer; und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern.“
Der Anfang ist gemacht. Aber noch bleibt der Blick gebannt auf jenes Geschehen, auf den freien Gott. Dass es wahr ist, dass es getan ist, dass Himmel und Erde da sind, dass das Wunder geschehen ist, dem gilt das ganze Staunen. Nicht das Werk, nein, der Schöpfer will verherrlicht werden – die Erde ist wüst und leer, aber Er ist der Herr – er, der das ganz Neue tut, das fremde, unbegreifliche Werk seiner Herrschaft und Liebe. „Die Erde war wüst und leer“, aber es war dennoch unsere Erde, die aus Gottes Hand hervorging und nun ihm bereit liegt, ihm unterworfen in frommer Anbetung. Gott wird von der Erde, die wüst und leer war, zuerst gepriesen. Er braucht nicht uns Menschen, um sich Ruhm zu bereiten, er schafft sich Anbetung aus der sprachlosen Welt, die stumm und gestaltlos in seinem Willen ruht, schlummert. „Und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern …“ Was kann über das Werk angesichts der Tat, was kann über das Geschöpf angesichts des Schöpfers anderes gesagt werden, als dass es finster ist und dass es in der Tiefe ist. Dass es sein Werk ist, das ist seine Ehre, und dass es finster vor ihm ist, das ist der Ruhm Seiner Schöpferherrlichkeit. In der Tiefe liegt es unter ihm. Wie wir schwindelnd in einen Abgrund vom hohen Berg herabschauen und die Nacht der Tiefe unter uns liegt, so ist die Erde ihm zu Füßen, fern, fremd, finster, tief, aber sein Werk. Die finstere Tiefe – das ist der erste Klang von der Macht der Finsternis, von der Passion Jesu Christi. Die Finsternis, die tehōm , die tihāmat , das babylonische „Urmeer“, beschließt in sich gerade in ihrem Tiefsein Macht, Gewalt; Macht und Gewalt, die jetzt dem Schöpfer noch zur Ehre dienen, die aber einmal vom Ursprung, vom Anfang losgerissen, Aufruhr und Empörung sind. Das Wüste, Leere, Finstere, Tiefe, das sich nicht selbst zur Gestalt verhelfen kann, die Zusammenballung des Gestaltlosen, dumpf Bewusstlosen, Ungeformten – denn in der Nacht, im Abgrund gibt es nur das Gestaltlose – ist sowohl der Ausdruck der schlechthinnigen Unterworfenheit wie der ungeahnten Gewalt des Gestaltlosen, die auf ihre Bindung in der Gestalt harrt.
Es ist ein Augenblick in Gott, in dem sich das Ungestaltete und sein Schöpfer gegenüber sind. Es ist ein Augenblick, von dem es heißt, Gottes Geist schwebte über den Wassern – es ist der Augenblick des Denkens Gottes, des Planens, des Erzeugens der Form. Es kann nicht heißen, dass das Verhältnis von Schöpfer und Geschöpf irgendwie angetastet wird, dass Gott hier mit seinem Geschöpf sich vermählt, um es fruchtbar zu machen, dass er mit ihm eins würde – die kosmogonische Vorstellung vom Weltenei, über dem die Gottheit brütet, ist hier jedenfalls nicht gemeint. Gott bleibt schlechthin der Schöpfer über der Tiefe, den Wassern. Aber dieser Gott, der der Schöpfer ist, hebt nun noch einmal an. Die Erschaffung des Gestaltlosen, der Leere, der Finsternis ist von der Erschaffung der Gestalt durch einen Augenblick Gottes unterschieden, der hier durch das Schweben des Geistes über den Wassern bezeichnet ist. Gott sinnt nach über sein Werk. Die Entbindung und zugleich die Bindung der gestaltlosen Gewalt in die Form, des Daseins ins Sosein, ist der Augenblick des Zögerns Gottes. Der Lobpreis, den Gott sich bereitet aus der rohen Finsternis des Ungestalteten, soll vollendet werden durch die Form. Noch ruht das Geschaffene gänzlich in seiner Hand und Macht, es hat kein eigenes Sein, und doch wird erst dort das Lob des Schöpfers vollendet, wo das Geschöpf sein eigenes Sein aus Gott empfängt und in eigenem Sein Gottes Sein preist. In der Gestaltschaffung entsagt der Schöpfer sich selbst, indem er seinem Werk Gestalt, eigenes Sein vor ihm gibt, aber er verherrlicht sich selbst, indem ihm dies Sein dient. Er steigert die Gewalt des Geschaffenen damit ins Unerhörte, denn er gibt ihm das eigene Sein als Gestalt. In der Gestalt ist die Schöpfung Gott in neuer Weise gegenüber und in diesem Gegenüber ihm ganz zu eigen.
Читать дальше