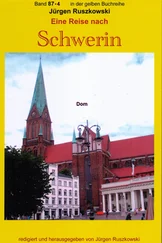Arne Bourgh - WIEDERSEHEN MIT WANGENAU
Здесь есть возможность читать онлайн «Arne Bourgh - WIEDERSEHEN MIT WANGENAU» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:WIEDERSEHEN MIT WANGENAU
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
WIEDERSEHEN MIT WANGENAU: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «WIEDERSEHEN MIT WANGENAU»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
WIEDERSEHEN MIT WANGENAU — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «WIEDERSEHEN MIT WANGENAU», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Chronine war damals in ihn verliebt gewesen. Zu meinem Erstaunen, wie ich zugeben muss. Bei allen Gelegenheiten schüttete sie mir ihr Herz aus. Zur gleichen Zeit traktierte er mich mit seinen mittelalterlichen, auf die aristotelische Nachfolge eingeschworenen Ansichten, die Hermeneutik, die Überlieferung, das geschriebenen Wort betreffend, die autorisierten Zeugnisse der Kirchenväter, wie er eigensinnig betonte, die Sünde im allgemeinen und die Sünde der Geburtenregelung im besonderen, der Prävention, Verhütung, vor allem die unsühnbare Todsünde der Abtreibung, die dem ordinären Mord gleichzusetzen sei, der wissentlichen und willentlichen Vernichtung von Leben. Worüber er sich stundenlang mit gesteigerter Unlogik und zunehmender Aggressivität auslassen konnte.
Ich hielt ihm den Zynismus der klerikalen Institution angesichts des Hungers, der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Dritten Welt und des Massensterbens von Kindern entgegen, die besser gar nicht hätten geboren werden sollen. Dagegen erfand er Tausend Ausflüchte, Rechtfertigungen, Erklärungen auf der Grundlage von ethisch-philosophischen Erwägungen, bis ich es aufgab, sie einzeln zu widerlegen. Als einziges erlaubte ich mir, ihn darauf hinzuweisen, dass es bislang nicht eine einzige stichhaltige philosophische Begründung von Ethik gäbe und dass die Philosophie bisher überhaupt so gut wie nichts erklärte. Das brachte ihn in Rage und liess ihn sich in der Behauptung verfangen, diesen Zweck erfülle die Religion. Folglich, konterte ich ironisch, definiere Religion Ethik in der Weise, dass Föten nicht angetastet werden dürften, weil eine derselben der Messias sein könne, bereits geborene Kinder aber nur gewöhnliche Menschen seien und recht und billig hungers verrecken oder in Kriegen umgebracht werden dürften.
In der Zwischenzeit schloss er sein Studium ab, verblieb jedoch weiterhin an der Universität. Er schrieb an einer Promotion über irgendein Seitenthema. Sein Mentor empfahl ihn als Spezialisten in Fragen des Abortus. Seither wurde er als akkreditierter Vertreter des wissenschaftlich geschulten Klerus zu Fernsehdiskussionen hinzugezogen. Stets gaben sie ihm das letzte und entscheidende Wort: das, was im Gedächtnis des Publikums haften bleibt.
Meine Schwester kommentierte einen seiner Auftritte, den sie miterlebte, mit den Worten: Finsterstes Mittelalter, was Frauen anbelangt. Was etwas heissen wollte bei ihr, die sonst Toleranz und Nachsicht in ihrer Person vereint. Weder politische Ranküne, noch die demagogischen Manipulationen der Parteien, noch die durchweg einseitigen, vom Interesse des privaten Informationsmonopols gesteuerten politischen Medienkommentare bringen sie aus der Fassung.
Was Chronine betraf, ersuchte er mich um Mithilfe, sie ihm vom Leibe zu halten. Natürlich ging ich darauf nicht ein. Was er vorbrachte, war unwahr. Ich warnte Chronine davor, sich auf ihn zu fixieren. Ihre Schwangerschaft erledigte das Problem. Glücklicherweise. Ich hatte ihn seither nicht mehr gesehen und legte auch keinen Wert darauf, ihm erneut zu begegnen.
Chronines Mutter und ich wechselten an jenem Abend erstmalig ein paar Worte. Sie beherrschte die Szene vollständig, auch wenn sie sich um des besseren Eindrucks willen bemühte, dezent im Hintergrund zu bleiben; eine gewisse Rivalität zwischen ihr und der Tochter blieb unverkennbar.
Woran ich mich besonders erinnerte, war der Blick, mit dem sie mich musterte: der gleiche wache, abschätzige, feindlich neugierige Ausdruck, den ich jetzt an Chronine bemerkte und den ich damals als Abwehr gegen einen vermeintlichen Anspruch auf ihre Tochter gedeutet hatte, als den sie meinen Besuch am achtzehnten Geburtstag missverstehen konnte. Eher, soviel gestand ich mir ein, hätte ich mich für sie interessieren können. Sie passte im Alter sehr wohl zu mir. Schwer verständlich, wieso ihr Mann sich von ihr losgesagt und dieser hohlen Figur von Geliebter zugewendet hatte.
Dezent, dabei wirkungsvoll geschminkt, sah sie blendend aus. Frisur und Kleidung waren betont unauffällig gehalten, aber von erlesenem Geschmack, die Bewegungen sorgfältig kalkuliert, sparsam und vornehm. Kurz, sie verbreitete eine flirrende Atmosphäre von Eros. Ich wusste, sie war gerade mitten in einer Affaire, angeblich mit einem argentinischen Tangolehrer – in Wahrheit kam er aus Bolivien –, von dem sie wenig später schwanger wurde und, da ihr Mann mit der Einstellung der Unterhaltszahlungen drohte, einen in ihrem Alter nicht ungefährlichen Abortus vornehmen liess. Damit war die Affaire zwar ausgestanden; der Eingriff hatte sie jedoch physisch erschöpft und psychisch mitgenommen. Von italienischer Abstammung, daher naturgemäss aus einer katholischen Umgebung kommend, brachte sie der Eingriff zusätzlich zu ihrer Scheidung sowohl mit der Kirche, als auch mit ihrer eigenen inneren Einstellung in Konflikt.
Als ich ihr hernach auf der Strasse begegnete, erkannte ich sie nicht wieder, so stark war sie gealtert. Sie hatte mich bereits passiert, bevor mir aufging, dass sie es gewesen war. Ich schämte mich, sie nicht gegrüsst und nicht wenigstens ein paar aufmerksame, aufmunternde Worte mit ihr geredet, sie vielleicht sogar zu einem Cafébesuch eingeladen zu haben in eine der besseren Confisérien. Zwar hätte ich nichts anderes mit ihr zu bereden gewusst als die überragende Musikalität und Begabung ihrer Tochter und deren aller Voraussicht nach erfolgreiche Zukunft als Musikerin; eine nähere private Unterhaltung hätte höchstwahrscheinlich auch andere interessante Züge an ihr offenbart, vielleicht sogar ein längeres Interesse meinerseits an ihr zur Folge gehabt und möglicherweise auch von ihrer Seite ein von Dankbarkeit gespeistes Entgegenkommen. Doch auch ohne diese Hintergedanken hätte ich einfach dem natürlichen Anstand Raum geben sollen.
Je nun, die Gelegenheit war verpasst. Zwischen uns hatte sich nichts angebahnt. Längere Zeit trug ich deswegen ein schlechtes Gewissen mit mir herum, schämte mich vor mir selbst und machte mir wohlbegründete Vorwürfe, sehr wohl wissend, dass meine Unachtsamkeit in ihren Augen als bewusste Unfreundlichkeit erschienen sein musste, ja erschienen war und ihr zu allem Überfluss ihren angegriffenen Zustand ungebührlich verdeutlicht hatte.
Wenn es meine Zeit irgend erlauben sollte, werde ich dich gern besuchen, antwortete ich freundlich aber kühl auf Chronines drängende Aufforderung.
Sie reichte mir, ihren hoch aufgeschwollenen Bauch vor sich her schiebend, die Hand, umarmte mich plötzlich und hauchte mir in einer Art entwaffnender töchterlicher Verbundenheit einen Kuss auf die Wange.
Danke, ich freue mich schon darauf, wenn du kommst, flüsterte sie an meinem Ohr. Und dann, aus etwas grösserem Abstand und in deutlich kühlerem Ton: Meine Mutter meint auch, es sei endlich einmal an der Zeit für dich, deine Heimat aufzusuchen. Deine eigentliche, die wirkliche Heimat.
Heimat gibt es nicht. Ich mag das Wort nicht. Es ist mir zu sentimental, sagte ich und dachte, dass Heimat bestenfalls dort ist, wo man sich wohl fühlt, seine Aufgaben erfüllt, Beziehungen aufbaut und Freunde hat. Das wollte ich erwidern, aber ich unterdrückte alle derartigen Äusserungen, die sie als belehrende Vorhaltungen empfinden musste. Ich wünschte ihr viel Glück für ihre Niederkunft und die Fahrt, die ich bei mir selbst für unverantwortlichen Leichtsinn hielt. Doch stand mir nicht an, mich in ihre Entscheidungen einzumischen, sie gar beeinflussen zu wollen. Darum gab ich ihr nur ein paar überflüssige wohlgemeinte Ratschläge mit auf den Weg.
Der Musiker, ihr Freund, ein um fünfzehn Jahre älterer, ausreichend bekannter Geiger, der sie nach ihrer und seiner Rückkehr zu heiraten gedachte, wie sie mir beide erklärten, stand linkisch daneben, von einem Fuss auf den anderen tretend, und vermied, mir in die Augen zu sehen.
Auch er war auf dem Sprung, zu verreisen. Er wollte für die gesamte Zeit ihrer Abwesenheit auf eine lange Konzertreise in die USA zu gehen, ein sabbatical , wie er sich ausdrückte und betonte, er könne eine solche Reise auf keinen Fall, schon der Karriere wegen nicht, verschieben. Der Augenblick von Chronines Abwesenheit böte sich ideal dafür an. Es handle sich nicht nur um von ihm zu absolvierende Konzerte, sondern um Kontakte und vor allem um die verschiedensten digitalen Aufnahmen, musikalische Alben, r ecordings , wie sie heute heissen: Quartette, Trios, Orchesteraufnahmen, viel Solistisches wie Rezitals, kurz etwas, das er nicht, um keinen Preis zurückstecken könne und wolle. Derartige Gelegenheiten böten sich nicht häufig; man dürfe sie keinesfalls ungenutzt vorübergehen lassen. Wie ich mir denken könne, seien sie eher selten. Schliesslich publizierte ich ja, wenn auch keine Literatur, er verzog sein Gesicht, als er es sagte, mich herablassend von der Seite her betrachtend, so doch wissenschaftliche Werke und wisse daher genau um die Probleme, die aufträten, wolle man Geschriebenes bei Zeitschriften oder Verlagen unterbringen, obwohl, er wisse es schon, die Modalitäten zwischen wissenschaftlichen und literarischen Publikation doch sehr verschieden seien. Als Editor von wissenschaftlichen Zeitschriften könne ich das bestätigen. Worauf ich die Schulter zuckte und bemerkte, dass ich es in der Literatur bislang nicht versucht habe, mir aber, wenn er meine, es gebe eine Differenz, sie mir durchaus vorstellen könne. In der Wissenschaft komme es auf Exaktheit und Beweiskraft an, was in der Literatur, der Belletristik, auch den anderen Künsten wohl kaum eine Rolle spiele. Da sei meines Wissens nichts zu beweisen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «WIEDERSEHEN MIT WANGENAU»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «WIEDERSEHEN MIT WANGENAU» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «WIEDERSEHEN MIT WANGENAU» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.