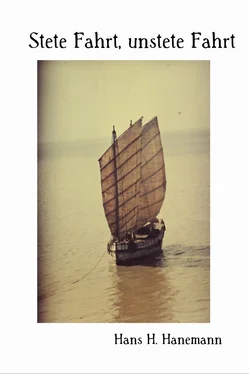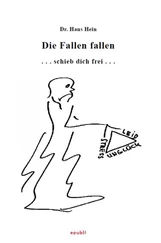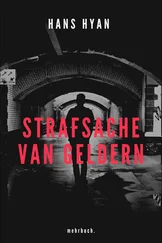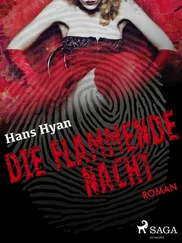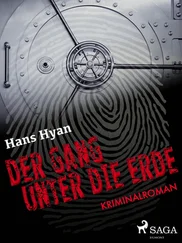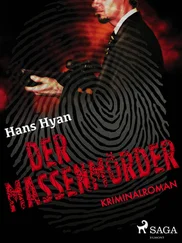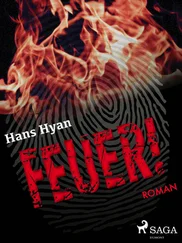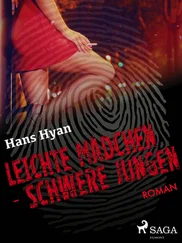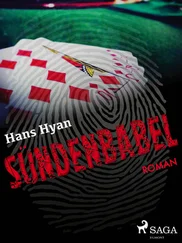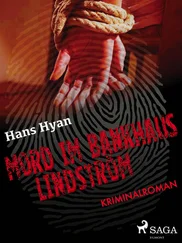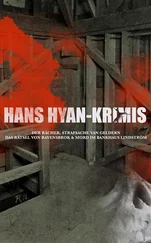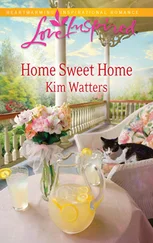Unsere Mutter hat eine ledige ältere Verwandte in Apen im Ammerland. Tante Sophie ist häufig bei uns, um Mutter im Haushalt zu unterstützen, vor allem dann, wenn Familienzuwachs erwartet wird und noch einige Zeit danach. Sie ist eine fleißige und kinderliebe alte Frau, stets in einem langen dunklen Rock mit halblanger grau gemusterter Schürze und einer dunklen Bluse gekleidet. Sie trägt hohe, eng geschnürte schwarze Stiefeletten, immer blank geputzt, und auf dem Kopf eine schwarze Haube, unter der ein wenig silbrig weiße Haare hervorlugen. Sie läßt mich manchmal, wenn sie das Mittagessen zubereitet, im brennenden Küchenherd mit einem Schürhaken herumstochern. Zur besorgten Mutter sagt sie beruhigend: „Lat de Jung man schürn, Leni, ick paß schon op.“ Dies erzählt mir Mutter viel später, als ich schon zur See fahre. Einmal nimmt mich die Tante ein paar Tage mit nach Apen, wo ihr Bruder mit seiner Familie lebt und wo auch ihr eigentliches zu Hause ist. Ihr Bruder betreibt dort eine Landschmiedewerkstatt. Seine beiden Jungen spielen mit mir, indem sie mich in einen Bollerwagen setzen und dann mit mir in hohem Tempo über die Landstraße laufen. Nachts schlafe ich bei Tante Sophie im Bett mit einer riesigen Federbettdecke zum Überdecken.
Zu meinen weiteren frühen Erinnerungen gehört, daß sich das Leben auf der Straße – die Langestraße bildete zusammen mit den benachbarten Straßen das Zentrum Oldenburgs – in der Zeit von 1924 bis nach 1933 sehr politisch abspielt. Häufig sind die Häuser beflaggt, die meisten mit den oldenburgischen Farben Blau-Rot, den Stadtfarben Gelb Rot Gelb Rot Gelb oder den alten, nicht mehr rechtmäßigen Reichsfarben von 1871 Schwarz-Weiß-Rot. Kaum ein Haus zeigt die republikanischen offiziellen Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold. Auch die alte Fahne unseres Hauses, die bei nationalen Feiertagen aus dem obersten Fenster gehisst wird, zeigt die Farben Schwarz-Weiß-Rot. Die schwarze Farbe ist allerdings schon reichlich verschlissen und sieht eher dunkelgrün aus, wenn man genau hinsieht. Die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg wird von den meisten Bürgern als Deutschlands Glanzzeit gesehen, der nach dem Krieg nach Holland geflohene Kaiser Wilhelm II. wird immer noch als der eigentliche legitime Herrscher des Reiches verehrt. Auch in unserem Haus hängt auf halber Treppe das Konterfei des Kaisers mit einem Adler auf seinem Helm. So ließ sich Wilhelm II. gern porträtieren. Von den politischen Linken wird er allerdings spöttisch „Wilhelm, der Holzhacker“ genannt. Er soll sich in seinem Asyl auf Schloß Doorn in Holland vorzugsweise mit der Versorgung seines Anwesens mit Heizmaterial beschäftigen und wirft die Holzscheite, die ihm seine Arbeiter auf schubkarren bringen, in hohem Bogen in den Holzschuppen. Er und seine Gemahlin, die ‚Kaiserin‘, legen Wert darauf, von allen Bediensteten und Besuchern des Anwesens mit „Majestät“ angesprochen zu werden.
An Stelle des Kaisers ist in der nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg entstandenen Weimarer*) Republik der Vorsitzende der Sozialdemokrarischen Partei, Friedrich Ebert, als Reichspräsident getreten, von der Nationalversammlung 1919 gewählt und 1922 vom Reichstag bestätigt unter Verzicht einer Volkswahl. Obwohl ein kluger Vermittler zwischen den verschiedenen und divergierenden politischen Interessen im Reich wurde ihm im Laufe seiner Amtszeit immer weniger Achtung entgegen gebracht und er war mehrmals genötigt, die Gerichte wegen gehässiger Verunglimpfung und persönlicher Beleidigung durch seine politischen Gegner anzurufen. Er starb im Februar 1925. An seine Stelle wurde in einer Volkswahl mit Unterstützung der Rechtsparteien der ehemalige kaiserliche Generafeldmaschall Paul von Beneckendorf und Hindenburg zum Reichspräsidenten gewählt. Ihm wurde im Laufe seiner Amtszeit wie ein Ersatzkaiser gehuldigt; er
war der legendäre „Sieger von Tannenberg und Masuren“, wo er 1914 mit seiner Armee die anstürmenden russischen Armeen zurück schlug. Von manchen Sachkennern wird allerdings das Verdienst des Sieges seinem Generalstabschef, General Ludendorff, zugebilligt. Jedenfalls war mit Hindenburg ein Mann an die Spitze des Reiches getreten, dem die nach der anfänglich republikanischen Euphorie mehrheitlich monarchisch gesinnte Bevölkerung eher zutraute, Deutschland nach dem „Schandvertrag von Versailles“ wieder mehr Ansehen in der Welt zu verschaffen als ein demokratischer Politiker, von welcher Partei er auch sein mochte, wobei unter „Ansehen in der Welt“ vor allem der Respekt vor militärischer Macht verstanden wurde. Hindenburg hat zwar zu Beginn seiner siebenjährigen Amtszeit den Eid auf die Verfassung des Deutschen Reiches geleistet, bekannt als die „Weimarer Verfassung“ und am 11. August 1919 in Kraft getreten, hat aber kein Liebesverhältnis zu der in der Verfassung festgelegten Demokratie. Praktisch bricht er den 1932 nach seiner Wiederwahl erneut geleisteten Eid mit der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933.
*) In Weimar wurde am 11. August 1919 die Verfassung des Deutschen Reiches (als Grundgesetz) von einer demokratisch gewählten Nationalversammlung beschlossen.
Ich erinnere mich an den Besuch Hindenburgs in Oldenburg kurz nach seiner ersten Wahl zum Reichspräsidenten 1925. Er war lange vor dem Ersten Weltkrieg Kommandeur des Infanterie Regiments 91 in Oldenburg gewesen, dessen Veteranen ihn mit Unterstützung der in Oldenburg stationierten Reichswehr zu einer Jubelfeier einluden. Die Straßen, die er in seiner von sechs Pferden bespannten offenen Kutsche passiert, darunter auch unsere Langestraße, sind mit Girlanden über den Straßen geschmückt, alle Häuser sind beflaggt, die Bürgersteige voll von Menschen, die von einer Polizei- und Reichswehrsoldatenkette zurück gehalten werden und die bei seiner Vorbeifahrt laut „Hoch Hoch Hoch“ rufen, wobei der „Greise Feldmarschall“, wie er in den nationalen Zeitungen gern genannt wird, ständig seinen Hut abnimmt und den Menschen, die ihm auch aus den offenen Fenstern der Häuser zujubeln, mit halb erhobener Hand zuwinkt. Da ich noch klein bin und nicht über die Fensterbrüstung sehen kann, hat mich einer meiner beiden Onkel, die auch zugegen sind, um an dem Ereignis dabei sein zu können, hoch gehoben und, mich festhaltend, auf die Fensterbank gestellt.
EA hat viel vom vergangenen Krieg, dem Ersten Weltkrieg, aufgeschnappt und erzählt mir darüber. Er singt mir vor „Siegreich woll’n wir Frankreich schlagen, sterben als ein tapf’rer Held ...“. Ich singe es ihm nach, verstehe das aber als Frage „Siegreich, woll’n wir Frankreich schlagen?“ Warum soll Siegreich Frankreich schlagen? Was hat Frankreich ihm denn getan? „Das verstehst du noch nich, da bist du noch viel zu klein für“, erwidert EA stolz, als ich ihn frage, warum wir mit Siegreich Frankreich schlagen sollen und wo denn Siegreich und Frankreich sind. Und sterben will ich auch nicht und auch kein tapferer Held sein. „Jeder Mann muß in den Krieg“, behauptet EA auf meine Frage, wer denn den Krieg macht, und warum die sich dann tot schießen und daß ich darum später nicht in den Krieg gehen will.
Solche Lieder, die den Krieg verherrlichen, werden nach dem Ersten Weltkrieg auch von Erwachsenen noch gesungen, als ob man die Schmach des verlorenen Krieges 1918 ungeschehen machen könnte durch einen neuen Krieg gegen Frankreich. Erst später lerne ich, daß dieses Lied 1914 von den einrückenden Soldaten, wenn nicht schon 1870/71 im Krieg gegen Frankreich, gesungen worden war.
Als ich einmal an unserem großen Mittagstisch naiv und ohne irgendwelches Verstehen frage, ob eine Frau auch ein Kind bekommen könne, wenn ihr Mann im Kriege wäre – vom vergangenen Krieg war ja bei uns häufig die Rede – , werden die Erwachsenen böse und verbitten sich solche Fragen. Selbst der älteste Bruder Ludwig empört sich scheinheilig. Er ist nicht wirklich prüde und hätte mich sicher unter vier Augen aufgeklärt. Gespräche über Kinder bekommen sind in unserer Familie und ebenso in uns bekannten Familien tabu. Sexualität und alles, was dazu gehört, werden in Gesprächen peinlich vermieden, zumindest nicht beim Namen genannt, jedenfalls nicht zwischen Eltern und Kindern. Daß unser „Dienstmädchen“ Grete uns beim sonnabendlichen Baden hilft, scheint unseren Eltern jedoch nichts auszumachen. Grete ist da wohl für sie eine Art Neutrum.
Читать дальше