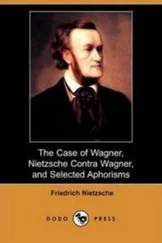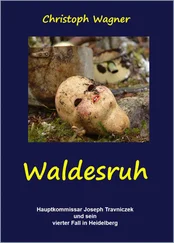Libidõ
„Killing some dead Time” (1998)
Die Trivialhitschmiede Zyx will jetzt auch das Poprockpublikum erobern. Mit den drei Norwegern von Libidõ ist ihnen auch gleich eine Combo zugeflogen, bei der man sich fragt, warum nicht längst eine im Genre erfahrenere Firma zugeschlagen hat. Libidõ spielen Britpop mit jener Begeisterung, die nur Epigonen aufbringen. Frech wie Oskar kopieren sie in „Revolving“ den elegischen Sound von Verve, verbinden ihn mit hallenden Dubgitarren und unaufhaltsam schiebendem Groove. Nicht alle Songs sind so stark, doch immer singt der Gitarrist und Vokalist Even Johansen, als sei der Popthron gerade verwaist und wartete nur auf einen stürmischen Prinzen, der sich dreist die Krone aufsetzt. Das ist natürlich falsch, aber wir wollen ihn einfach in dem Glauben lassen, okay?
Lisa Loeb
„Firecracker” (1998)
Achtung! Diese Frau sieht nur so aus, als sei sie harmlos. Gern trägt sie Zöpfe, und ihre Hornbrille erzählt vom vertrauten Verhältnis zu ihrer Krankenkasse und der Absicht, uns „Uups, schlechter Geschmack“ denken zu lassen. Sie spielt halt gern mit den Vorstellungen, die wir von ihr und ihren Zöpfen haben. Und sie setzt Gefühle als Waffe ein: „I stop cryin’/if you stop lyin’/to me.“ Gut, sie hat nicht die größten Melodien der Welt, aber wie sie singt, mit diesem raschen Changieren zwischen Verletzlichkeit und Toughness: Das macht ihre Songs größer, als sie eigentlich sind. Zudem hat Lisa Selbstironie – auf diese stolze amerikanische Art, bei der man wächst, je kleiner man sich macht.
Lou Reed
„Perfect Night” (1998)
Auf sein Charisma konnte er immer eher bauen als auf seine Qualitäten als Entertainer, was manches Reed-Konzert vorm Desaster bewahrte. Und schon oft in seiner Karriere versuchte er mit allen technischen Mitteln die Quadratur des Kreises: ein Konzert so einzufangen, wie er selbst es erlebt mitten auf der Bühne, glasklar, ohne Störung. In den 70ern experimentierte Lou Reed deshalb mit Kunstkopf-Stereofonie, heute versucht er’s mit Akustikgitarre und Digitaltechnik. Klanglich geriet ihm die karg instrumentierte „Perfect Night“ denn auch superb – und viel mehr kann der Albumtitel auch nicht meinen. Denn stimmlich ist Reed ziemlich außer Form, das Verfehlen aller Töne, von jeher sein vokales Markenzeichen, wirkt hier oft weniger cool als peinigend. Deshalb war seine beste Idee die: „Walk on the wild Side“ NICHT zu spielen.
Madonna
„Ray of Light” (1998)
Im Video spielt sie die schwarze Witwe, doch Bedrohung, Geheimnis, Verrat gehen von dieser Madonna nicht mehr aus. Ihr Muttertum hat sie weichgemacht, ihr mit Trance gespülter, ethnoverschnörkelter Pop hat statt Dominanz nur noch Daunigkeit. Natürlich: ALLES ist besser, als sie „Don’t cry for me, Argentina“ juchzen zu hören, doch Songtexte von der Qualität wie „Frozen“ taugen nur fürs Poesiealbum. Das einzige, was die weder vokal noch kompositorisch sonderlich begabte Madonna aus der Masse hervorhob, war immer ihr trüffelschweinartiges Gespür fürs nächste zu brechende Tabu. Das fehlt auf „Ray of Light“. Was bleibt übrig? Ein Haufen goldener Schallplatten – für die Vorbestellungen.
Marion
„The Program” (1998)
Es lag an einem Rechtsstreit, dass seit Monaten dieses Album dalag und nicht rezensiert werden durfte. Man wird es dereinst als großes Glück feiern, dass es nun doch noch erscheint. Denn der Texter und Sänger Jaime Harding und seinen Kollegen ist ein Opus Magnum des Britpop gelungen, ein grandioses, mit wunderbaren Melodien bestücktes Wunderwerk ohne Makel. Jeder Song – nicht nur „Sparkle“ – funkelt wie ein Diamant, wird getragen von der Strahlkraft perfekt gesetzter Streicher (Produzent: Johnny Marr!), getrieben von akustischen Gitarren und Hardings Gesang, der auf eine solche Art verschämt hymnisch ist, dass er uns rührt bis ins Mark. Eine Sternstunde des Pop.
Martial Solal with Gary Peacock & Paul Motian
„Just Friends” (1998)
„Im Jazz geht’s nur um eins: Freundschaft“, behauptet dreist der Covertext. Abgesehen davon, dass auch Spannungen zwischen den Beteiligten in aufregende Musik münden können, hat er natürlich Recht. Beim Trioprojekt des 70-jährigen französischen Pianoveteranen Martial Solal aber heißt der Zündstoff Harmonie, gewachsen aus langer Freundschaft. Den Drummer Paul Motian etwa kennt Solal schon seit 1963. Mit ihm und dem ehrwürdigen Gary Peacock am Bass swingt Solal fröhlich und elegant durch neun exquisite Kompositionen, die das Trio an einem Tag im Juli 1997 einspielte. Und plötzlich klingt auch Gershwins „Summertime“ nicht mehr nach schwüler Trägheit, sondern wogt sachte heran wie die Wellen an den Strand der Côte d’Azur.
Massive Attack
„Mezzanine” (1998)
War ihnen der Hype zu viel? Die Kultformation aus Bristol präsentiert die Hitlosigkeit ihres Albums zu offen, um keine Absicht dahinter zu vermuten. Das Album schleicht bedrohlich dahin, weit und breit keine „Unfinished Symphony“, selbst die von Cocteau-Twin Liz Fraser gastgesungene Single „Teardrop“ reicht höchstens gerade so heran; dafür gibt es mit größter Sorgfalt gefettete Bässe, die zum Tieffrequentesten gehören, das Boxen je erzittern ließ. Und das Verschlurfte, Kratzige, Anthrazite dieses Sounds ist weiter weg vom Soul als je ein MA-Album zuvor – der Portishead-Effekt? Harter Stoff jedenfalls für die Tanzflächen. Doch wer es mag, um Mitternacht in den Randbezirken der Stadt von raunenden Nachtgeschöpfen hypnotisiert zu werden, für den ist dieses Album die Droge des Monats.
Matthew Ryan
„May Day” (1998)
„Ich habe die Zukunft des Rock gesehen“, jubelte Lester Bangs 1976, „und ihr Name ist Bruce Springsteen.“ Jetzt, 1998, ist die Zukunft schon halb Vergangenheit und der Rock in Springsteens Schaffen ganz passé. Aber ich habe die Zukunft des Bossrock gesehen, und ihr Name ist Matthew Ryan. Amerika brauchte wieder einen wie ihn – das sieht man schon daran, dass die verzweifelte Grammy-Jury jüngst keinen Jüngeren als Bob Dylan zum Auszeichnen fand. Doch Ryan hat alles, was große US-Rocker immer ausmachte: eine knorrige Countrybasis, Heiserkeit, die Gelassenheit des Genies, Melodien für Millionen und die Souveränität, große Songs in grobes Sackleinen zu stecken. Könnte nur Lester Bangs dieses Album noch erleben! „May Day“ ist so gut, dass sein Ruhm auch bis in den Rockhimmel dringen wird. Und die Grammy-Jury hat’s nächstes Jahr wirklich leicht.
Miles
„The Day I vanished” (1998)
Nach dem sperrigen 94er-Debüt „Baboon“ haben sich Miles aus Würzburg kräftig geschüttelt, und alles fiel von ihnen ab, was noch hätte hinderlich sein können auf dem Weg zur deutschen Gitarrenhoffnung. Plötzlich funkeln ihre Songs wie Diamanten. Ihre Einflüsse – von Beatles bis Nirvana – fließen sämig ein in den neuen Sound. Sie scheuen sich nicht, mal wie „I am the Walrus“ anzufangen – weil sie wissen, dass sie die Kopie doch wieder verwandeln können in ein Miles-Original. Große Melodien, Orgeln an den richtigen Stellen und mit Tobias Kuhn ein Sänger, der hochfrequent knödelt und dabei nicht nervt: Gut gemacht, Jungs. Und bitte nicht gleich wieder verschwinden.
Hier haben wir die Nicolette des Nordens. Mòa kommt aus Island, doch sie verfolgt ein ähnliches Konzept wie ihre Kollegin aus London: heller Jazzgesang zu gefälligen Breakbeats, Vibrati in elektronischem Klangdesign. Der Sound orientiert sich zudem deutlich an den jüngsten Errungenschaften der Landsfrau Björk, will aber nicht ganz so raffiniert und kühl sein. Bei Mòa, die auch mal Zarah Leander sampelt oder einen Housesong wie „Raining in my Heart“ mit Vibrafongeklöppel fein verziert, scheint mehr Lebens- und Sangesfreude durch als Kunstwille. Ein sehr interessantes Album. Nur Nicolette wird es bitter schmecken: Ihr Monopol ist gebrochen.
Читать дальше