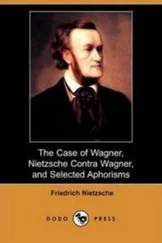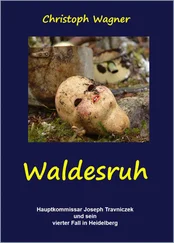Duffy
„I love my Friends” (1998)
Dem Mitbegründer der stilbewussten Popband Duran Duran hätte man solch ergreifende Schlichtheit nicht zugetraut, aber der Song „The Postcard“ ist rührend und wunderbar. Stephen Duffy begleitet die Geschichte vom Verlust einer alten Freundin mit simplem Folkpicking – die Durchschlagskraft des Einfachen. „The Postcard“ beharrt selbst im Zeitalter der (mindestens) 24 Aufnahmekanäle darauf, dass ein großer Song auch im Kleinen funktionieren muss. Manchmal ist sein Pop nur nett – doch die 150 Sekunden von „The Postcard“ werden übrigbleiben wie Dylans „Girl from the north Country“ oder Van Zandts „Tecumseh Valley“. Ein einziger solcher Song ist viel für ein Album. Sogar für eine Karriere.
Courtney Love schätzt Herrn Smith. Aber sie findet es blöd von ihm, dass er extra mit schlechten Musikern spielt, um ja nicht berühmt zu werden. Wird nichts nützen. Der gern im Dunkeln wirkende Songwriter steht wider Willen schon am Rand des Spotlichts. Er konnte die Bitte seines Freundes Gus van Sant nicht abschlagen, ein paar seiner Songs für irgendeinen Film verwenden zu dürfen, und dann kriegt der Streifen, „Good Will Hunting“, einen Oscar. Pech für Smith. Denn jetzt wollen alle mehr von ihm, sogar die alten verwuselten Alben werden neu aufgelegt, und für sein neues, „XO“, hat ihn der reichste Verlag der Welt an der Gurgel: Spielbergs Dreamworks-Label. Aus Elliot, dem Muffelmonster, wird jetzt wohl ein Star. Zumal seine früher verdrehten, schludrigen Songs plötzlich einen Popappeal entfalten, der Mr. Smith eigentlich ekeln müsste. Er wird jetzt noch berühmter. Mist.
Essen
„King Size Blues” (1998)
Auf der Suche nach kühler Melancholie stößt man auf die größten Schätze noch immer in den frühen 80ern. Essen bestehen aus Darren Moss und Paul Robinson, und sie kommen aus dem Dunstkreis der Sneaker Pimps, streben aber weg vom TripHop – und landen am Gartenzaun von Icehouse. Ihr Klangkosmos ist so tief und blau wie das Meer, das sich über die ganze Breite des aufgeklappten Booklets erstreckt; ihr Piano klingt wie das aus der Bar am Ende des Universums. Klar, dass Tralalatexte tabu sind bei so viel cooler Traurigkeit, in der gut tauchen ist. Also geht es um „God & The Devil“, um „Sleep“, den „King of the Rain“ und, schließlich, ums „Amen“. Doch keine Angst: Dieses Album ist – trotz aller Sample- und Klangfinessen, trotz seiner streicherartigen Wogen und den flüsternden, zischelnden Beats – gar nicht prätentiös. Sondern tiefblau. Wie ein Film von Derek Jarman.
Finitribe
„Sleazy Listening” (1998)
Sie legen das Album vor, das Tricky nicht mehr gelingen will. Raunenden, von dumpfen Drums durchrollten TripHop füllen sie mit Folkgesang und Rezitationen, und lässig veredeln sie manchen Groove mit süßen Geigen. Salonmusik goes Bristol – dabei kommen Finitribe aus Schottland und sind seit 16 Jahren im Geschäft, was die Souveräntät der Mischung erklärt. Jungen Hüpfern wäre das Ganze wahrscheinlich entglitten, bei Finitribe klingt das wie aus einem Guss. Ihre Musik steht für den grenzenlosen Zugriff auf viele geomusikalische Traditionen und dafür, wie man dabei den Überblick behält. Ein junger Hüpfer wie Tricky hat ihn verloren.
Fury In The Slaughterhouse
„Nowhere … Fast!” (1998)
Sie müssen dagesessen haben mit diesem ziellosen Durchschnittsalbum, das sich mal halbherzig am Ska versucht („Balm for the Soul“), mal mit Drummaschine zur Akustischen Hipness vortäuscht, es aber nicht übers Niveau einer späten Dire-Straits-Schnulze schafft („Romeo & Juliet“), sie saßen also da und wussten wahrscheinlich nicht, wie das ungeratene Kind nun heißen soll. Oh je, die Journaille, könnte Kai-Uwe Wingenfelder gejammert haben, die wird uns mächtig rannehmen. Warum ironisieren wir nicht präventiv – denn Fury sind schlau, richtige Kopfrocker – die Reaktion der sog. Kritiker und nennen die CD einfach „Nowhere … Fast!“? Einen Moment mag es still gewesen sein, ehe die Restband losjubelte: „Wahnsinnsidee, Kai-Uwe!“ Und wirklich: Wahnsinnsidee.
Gandalf
„Barakaya” (1998)
In den 80ern gelangen dem Gitarristen Gandalf entspannende, klangvolle Instrumentalalben, die sich als TV-Pausenfüller genauso eigneten wie zur Einstimmung auf traute Abende zu zweit. Jetzt, beim Sattva-Label, ist der Komponist indianophil geworden, lässt sich vom Kometen Hale-Bopp inspirieren und schwankt wie trunken zwischen Muzak, Ethno und Esoterik. Manchmal gelingen ihm atmosphärische Klangbilder im Ambientstil, ein andermal beamt er uns in den Karstadt-Hausaufzug. Nie trübt ein Stäubchen den Schimmer dieser Politur, und wenn die Gastmusikerin Emily Burridge alias White Horse die Celli und Vocals arrangiert, geht Worldbeatromantikern der Medizinbeutel unterm Poncho auf.
Gidon Kremer
„Le Cinéma” (1998)
Kremers Geigenspektrum ist extrem, es reicht von Beethoven bis Stockhausen. Und der Lette ist Kinofan, Scorekomponisten schätzt er ebenso. Allerdings ist seine Auswahl hier ziemlich klassisch und weniger wagemutig als im E-Bereich: Chaplin („Smile“), Schostakowitsch („Romanze“) oder Rota („Improvviso“). Er spielt mit der Hingabe des Bildersüchtigen, mit jener rührenden Wehmut und Wärme, die etwa Chaplins sentimentale Meisterwerke vorm Kitsch retteten. Sein Schmelz wird fein abgefedert von Oleg Maisenberg am Piano; so kommt auch Verschmitzheit nicht zu kurz. Ein Album fast so schön wie Chaplins „Zirkus“.
Goldie
„Saturnz returnz” (1998)
Der Junglegott ist zurück aus der inneren Emigration, und siehe, dort empfing er die neuen Breakbeatggebote, und eins davon verkündet: Es muss nicht immer tuckern und pluckern. Für das mehr als einstündige „Mother“ engagierte Goldie gar ein Streichorchester und schichtet das Präludium zum Monument von wagnerianischer Wucht auf, ehe nach 21-einhalb Minuten der erste Beat pocht. „Es ist nicht einfach, aus mir schlau zu werden“, gockelt Goldie. Hier will einer endlich so ernst sein, wie er längst genommen wird – und dabei kommt nichts weiter raus als ein Heißluftballon. Gut, dass „Mother“ nur die Hälfte des Doppelalbums ausmacht, dass auf der anderen hochmelodischer Drum & Bass pocht, mit Bowie, Noel und KRS One als Gaststars und allen Seitensprüngen zwischen Industrial, Jazz und Easy Listening, die das Genre nur erlaubt. Diese Stücke räumen dann wie Rennie den Magen auf – kurieren aber trotzdem den Blähbauch nicht richtig, den „Mother“ uns eingebrockt hat.
Grant Lee Buffalo
„Jubilee” (1998)
Selten war ein Albumname so sehr Programm wie auf dem vierten Album der US-Band. Ihr mahlender, langsamer Folkrock wogt so verzweifelt euphorisch dahin wie nie. Der aus 14 Songs bestehende Zyklus ist ein großer Hymnus in der Nacht, vorgetragen mit der Kraft des Soul, und mit Stücken wie „Truly, truly“ knüpfen sie wieder an die große kompositorische Qualität ihres Erstlings „Fuzzy“ an. Wie anerkannt die Band um Sänger Grant Lee Phillips inzwischen ist, zeigt die Zahl der gern vorbeischauenden Gäste: Michel Stipe, E oder Robyn Hitchcock steuerten Kleinigkeiten bei. Wäre aber nicht nötig gewesen; GLB sind inzwischen selber groß.
Haindling
„Zwischenlandung” (1998)
Der bayerische Querkopf Hans-Jürgen Buchner, ein Wilderer in den Wäldern von Folklore und Freistil, wechselt gern den Forst. Diesmal seziert er zum Humtata der Blosmusigg die deutsche Sprache und ihre Floskeln, spricht über Liebe in Anführungszeichen, und dann packt ihn doch wieder wilde Experimentierlust, was sogleich zu weltmusikalischen Ausflügen führt. Bei Haindling haben Bayern und China eine gemeinsame Grenze, genauso Ambient und Mundart-Reggae. Und wer außer Buchner weiß schon, dass die Ägypter eine besondere Art haben, Tamburin zu spielen? Hier führt er’s vor, insgesamt weniger skurril als früher, manchmal gar schier easy anzuhören, aber allemal auf- und erregend wie sonst wenig, was aus Bayern kommt.
Читать дальше