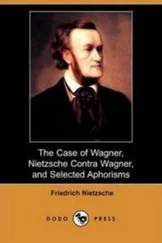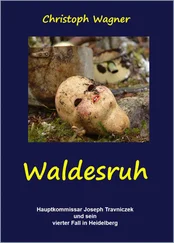Genf
„Import/Export” (1997)
Und es erschien der Geist von Can und sprach: Kreuzet Elektronik und Gitarren und vergesset den Groove nicht, so ist euch die Zukunft des Rock gewiss. Die Kölner Oliver Brand (dr, keyb), Olaf Karnik (g) und Jens Massel (keyb) hörten die Botschaft wohl und taten, wie ihnen geheißen, fügten noch einen anthrazit schimmernden Bass bei, wilderten in Ambient und Indierock – und hier ist er, der verführerische instrumentale Fluss aus analogen und digitalen Quellen, der uns eine Ahnung gibt von der Zukunft. Oder ist sie es schon? Musik wie ein Strudel, und ehe man sich versieht, ist die Nacht um, und niemand weiß, wie sie verging. Ganz klar, das Genre heißt Krautgroove. Und Genf liegen in Führung, noch vor Kreidler.
Greg Garing
„Alone” (1997)
Mit der Stimme einer Countrychanteuse singen zu einer multiplen Rootsmelange, die man alleine anrührte, nachdem man die US-Musikgeschichte verdaut hat wie Quentin Tarantino die Filmhistorie: Das würde ja schon reichen. Aber der New Yorker Greg Garing hat das alles auch noch – mit Fuzz, Fiedeln, Flöten und mehr – fast allein instrumentiert; ein Universalgenie, dem Hank Williams und Roy Orbison im Kopf herumspuken, der irgendwo zwischen Robert Johnson, Prince und Tricky einen einsamen Hobbykeller bezogen hat. „Let me in, let me in“, fordert er im Titelsong, „bring this pain to an end.“ Gut, Greg: Willkommen im Gewusel der Postmoderne; wir brauchen einen wie dich. Und Alben wie dieses, aus denen mehr herausfließt als in sie einging.
Jerry Alfred & The Medicine Beat
„Nendää” (1997)
In der Weltmusik tummeln sich viele Romantiker, die das Edle im Wilden feiern. Alfred ist Indianer, lässt sich vom rosaroten Ethnogetue aber nicht vereinnahmen. Allerdings wagt der Yukon aus Kanada auf seiner zweiten Platte kaum noch das Puristische, nämlich die sonore Klage zur Solotrommel. Doch wenn er E-Gitarren, Akkordeon und Keyboards einbaut, dann folgt das stets seiner musikalischen Vision, und die ist hymnisch und optimistisch. Ein souveräner Künstler, der Westliches nutzt, wenn es seiner Kunst nützt. Auf dem neuen Genresampler „Shaman“ ist er natürlich auch drauf, gemeinsam mit indiophilen Acts wie Tulku oder Raindance, alle allerdings vom Labelchef Oliver Shanti für unsere Ohren harmonisiert.
Jhana
„Sentient Being” (1997)
Sittenspiegel Pop: In den 60ern saßen Pärchen mit Westerngitarre im Gras und sangen von Blümchen im Haar. Ganz anders die 90er und somit auch Stephanie Soma (sic!) alias Jhana: Sie sind so unverblümt, als könne ein „fuck“ im Zeitalter der „Hausfrauen betreiben SM“-Talkshows noch Tabus brechen. Aber wie das so ist: Hinter der Vulgärschnauze (parental guidance!) verbirgt sich eine verletzliche Seele auf der Suche nach Zärtlichkeit statt rüder Rammelei: „Say something sexy he said/and make it dirty it’s better/He closed his eyes instead/watch the pornography inside his head“. So ist das Album nur auf den ersten Blick so, wie sich manche Zeitgeistmagazine den Sex der 90er vorstellen, nämlich schräg, tabulos, konfus, kalt. Also eher unbefriedigend? Kommt ganz auf Ihre Neigung an.
Jocelyn B. Smith
„Live in Berlin” (1997)
Die New Yorker Soulsängerin ist in Berlin weltberühmt, vor allem im Quasimodo-Club, wo diese Live-CD entstand. In der Restrepublik kennt man ihre Stimme: Sie sang im Film „König der Löwen“ den Titelsong vom „Ewigen Kreis“. Smith röhrt sich im Beisein von Chor und Schweineorgel durch Eigenes und Fremdes, versenkt sich episch in „Have you ever seen the Rain“ und lässt, als Köder für die Massen, dem Pop im Soul viel Raum. Manchmal will sie zu viel, und dann geht es schief. Die Schnulze „When I need you“ missrät ihr zum Vibratopomp im Whitney-Houston-Stil. Macht nichts: Sie wird trotzdem ihren Weg machen.
Laika
„Sounds of the Satellites” (1997)
Die Musik der britischen Programmierer und Komponisten Guy Fixsen und Margaret Fiedler gleitet wie eine Schlange durch metallische Ödnis. Laikas Songs sind von solch flinker sequenzieller Monotonie, dass sie uns ihre innere Wandlung gleichsam subkutan verabreichen. Mitten im kalten Rhythmusfluss kauert die Stimme von Margaret Fiedler, eine Verkörperung von Restwärme und jenen fernen Tagen, als Menschen noch im Mondlicht anbandelten, ohne von den Argusaugen der Satelliten fixiert zu werden. Fiedler ist für Laika, was Martina für Tricky ist: menschliche Komponente in unmenschlicher Umgebung. Wie die Hündin Laika, das erste irdische Wesen im Orbit: geborgen im Kokon des Sputniks und doch rettungslos verloren ans Weltall. Das Album verklingt mit Laikas Herzschlägen, die damals zur Erde gefunkt wurden. Es sind die erschütterndsten Klänge, die man sich denken kann.
Leo Kottke
„Standing in my Shoes” (1997)
Manche Stücke folgen einem Komponisten ein Künstlerleben lang. Für Leo Kottke, den Gitarristen mit den magischen Fingern und der Stimme „wie ein Gänsefurz“ (John Fahey), ist „Vaseline Machine Gun“ so eins. Das Wunder seiner Hände, ihre Geschwindigkeit, ihr messerscharfes Picking: Nirgendwo in seinem Werk findet es sich reiner, atemberaubender als in den drei Minuten dieses Songs, der nun, mit voller Berechtigung, auf seinem 24. Album zurückkehrt – aber langsamer, bedächtiger. Wie eh und je dauert das Album keine 40 Minuten, Kottke pfeift auf die Aufgeblasenheit der CD-Ära, duettiert dagegen mit dem Meister der Nashville-Gitarre, Chet Atkins. Eine grundsolide CD, die die Welt nicht ändern wird, aber sie ein klein wenig reicher macht.
Manuel Göttsching
„Dream & Desire” (1997)
Das Leben ist ein langer ruhiger Fluss. Die Musik des Ashra-Gründers auch. Auf eine winddurchtoste Synthiespur türmt er Gitarrenlagen, schreibt instrumentale Gedichte auf drei lange Bögen akustisches Bütten. Pointenlose übrigens: Das Ziel ist der Weg. Wichtig für Göttsching sind Entwicklung, Tiefe, die Zeit, sich in luftige Klangräume vorzutasten. Er ist ein Dichter der unmerklichen Verschiebung. „Dream“ und „Desire“ wurden 1977 im Radio gesendet (Stück 3, „Despair“, ist ein CD-Bonus) und Jahre später wiederentdeckt. Das Reissue erreicht zwar nicht die zeitlose Klasse von „Blackouts“, zeigt aber den Tranceteens, wo ihre Wurzeln liegen.
Marie Bergman
„Fruit” (1997)
Ewig hat sie Rock gesungen, dann wechselte sie zum Jazz – und wir fallen auf die Knie vor dieser begnadeten Stimme. Denn die Mitt-40erin Marie Bergmann aus Schweden ist das missing link zwischen Billie Holiday und Rickie Lee Jones. Sie ist, was immer sie sein möchte, einfach so, ganz leicht: scheues Mädchen, Femme fatale, flüsternde Kassandra oder die swingende Königin des Ballsaals. Marie Bergmann ist eine Offenbarung des Jazzgesangs, und – Miles sei Dank – hat ihr Produzent dieses Wunder in Arrangements gesteckt, die nichts überspülen, sondern all ihre Fähigkeiten freilegen. Nach diesem Album fragt man sich, wie man leben konnte, ohne einen Song wie „Wish someone would care“ zu kennen. Ein Album für die Annalen.
Moby
„I like to score” (1997)
Natürlich mag es der US-Komponist aus dem Technodunstkreis, wenn er erfolgreich den Nerv der Zeit und jenen der Damen trifft, doch sein Albumtitel ist gar tripeldeutig: Moby mag nämlich auch das Komponieren und Adaptieren („James Bond Theme“) von Filmmusik. Hier erreicht er, so widersprüchlich es klingt, eine gleichsam oberflächliche Tiefe; unverschämt direkt zielt er auf die Rezeptoren fürs Schöne in uns. Moby liebt die unverschleierten Reize, das wohlige Stöhnen im synthetischen Soundbad, den pumpenden Simpelbeat hinter kathedralischen Klangtiefen. Wie er dennoch immer wieder den Kitsch nur lächelnd streift, bleibt rätselhaft; vielleicht spüren wir die dunklen Seiten dieses Klangmalers, die nur manchmal klar zu sehen sind – etwa im schneidenden Joy-Division-Cover „New Dawn fades“, das wir schon vom letztjährigen Tributealbum an die britischen Düsterlegenden kennen. Der Rest seiner gesammelten Scores ist eines immer: oberflächlich tief.
Читать дальше