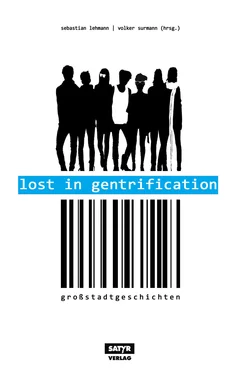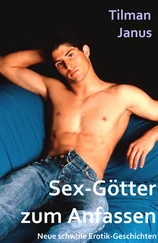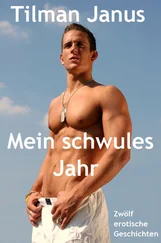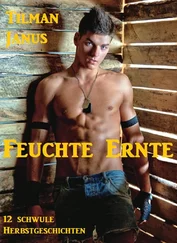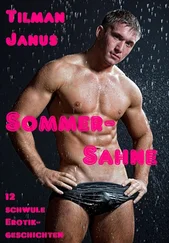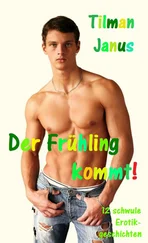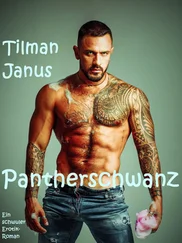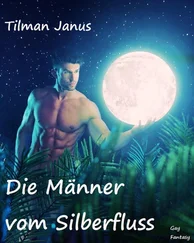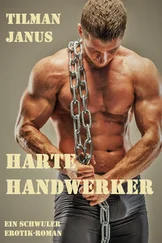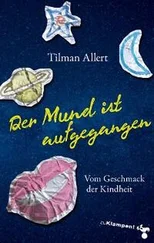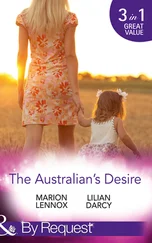Tilman Birr - Lost in Gentrification
Здесь есть возможность читать онлайн «Tilman Birr - Lost in Gentrification» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. ISBN: , Жанр: Языкознание, Критика, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Lost in Gentrification
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:9783944035017
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Lost in Gentrification: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Lost in Gentrification»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Lost in Gentrification — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Lost in Gentrification», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
In einem Radius von zehn Minuten Laufweite gab es Mitte der Neunziger kaum eine Kneipe, kaum ein Café, in dem ich mich guten Gewissens mit einer Frau hätte verabreden können. Ein biederes Eiscafé oder Juhnkes Eck – das wäre die Wahl gewesen, wenn man von der ost-alternativen tagung absah. An einem heißen Sommertag 1994 saß ich mit einem Freund in der Eckkneipe Gleis 13 , und fragte den Wirt, ob wir einen Tisch nach draußen stellen könnten. Er glotzte mich an, als hätte ich einen Cappuccino bestellt. Die Angestellten des nun an seiner Stelle befindlichen Via Nova wundern sich auf ähnliche Art, wenn man im Sommer nicht draußen sitzt. Zwischen 1994 und 1996 beobachtete ich fünf vergebliche Versuche, in der Simon-Dach-Straße ein Café zu eröffnen. Alle mussten mangels Kundschaft schließen.
Doch 1997 tat sich etwas. In der Simon-Dach-Straße hatte das erste Café nicht nur einen Versuch gestartet, sondern diesen Versuch sogar überlebt. Von da an verdoppelte sich die Cafédichte im Jahrestakt. Ein kleiner, aber feiner Buchladen eröffnete in der Wühlischstraße. In den Second-Hand-Läden hing nicht mehr nur Ramsch, den man bei Humana nicht feilzubieten wagte. Eine Öko-Coop entstand, die später dem Druck mehrerer Bioläden ausgesetzt war. Häuser wurden saniert – manche sanft, die meisten aggressiv.
Als schließlich in der Kopernikusstraße ein Hundefriseur öffnete, wusste man: Die Gegend wird gentrifiziert. Das Haus, in dem ich wohnte, wirkte in der Libauer Straße wie ein Mitesser in einem hübschen Gesicht. Die Erbengemeinschaft konnte sich seit der Wende nicht einigen, und so beließen es die Verwalter beim Allernötigsten. Als ich achtunddreißig wurde, hatte ich schließlich die Nase voll vom Außenklo und zog mit Freundin nach Treptow. Eine putzige Glosse über meinen Umzug endete damals mit der Bemerkung, dass ich in Treptow mitnichten der einzige Schriftsteller sein würde, sondern lediglich der erste. Es scheint sich zu bewahrheiten. Die Biokette LPG hat eine Filiale in der Nähe eröffnet, und der Vollkornbäcker hat weniger Schwierigkeiten, sein Publikum zu halten als jener Imbissladen, in dem der Dönerspieß zehn Tage braucht, bis er – grau vom Zigarettenrauch – runtergebrutzelt ist.
Ich spaziere weiter und bin mir sicher: Die Pappeln werden gefällt. Selbst wenn der Eigentümer dafür nicht die Genehmigung bekommt – die Ordnungsstrafe wird aus der Portokasse bezahlt. Auf dem RAW-Gelände in Friedrichshain geschah dasselbe. Gestern den Öko-Investor spielen, morgen Bäume fällen; wahrscheinlich ohne gravierende Selbstzweifel. Adé Pappeln! Adé Naturnähe-Illusion. Welcome to the next Caipirinha-Bezirk.
Der Boom der Investoren, so ein Flugblatt der Protestierer, nimmt aggressive Züge an. So sei der Obstgarten neben der Neuapostolischen Kirche plattgemacht worden, um dort zu bauen. Ich zähle fünfunddreißig Baumstümpfe. Wer kann was gegen eine Verschönerung haben? Gegen Innenklos? Gegen Vollkornbäcker statt Gammeldöner? Und wann kippt es? Verdrängung ist nicht immer bösartig, fies, gewalttätig, durch dreiste Mieterhöhungen am Rande der Illegalität verursacht. Gentrifizierung und die ihr folgende Segregation funktioniert vor allem dadurch, dass weniger wohlhabenden Zuzugswilligen der Weg in den Bezirk versperrt bleibt.
Bei zwei Brachen nun haben sich ein paar Leute zusammengetan, ihr Gespartes zusammengelegt und bauen nun zwei Häuser – hell und transparent, mit Spielplatz und Wiese. Und doch werden sie bedroht, nicht von den Bullen, sondern von den Anti-Gentrifizierern, die die Häuser mit Farbbeuteln und Steinen angreifen. Ein wenig beneide auch ich die dort wohnenden um ihre schöne Aussicht auf den Kanal. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich dort wohnte, einmal täglich das Fenster aufreißen und den Rauchhaus-Song von Ton Steine Scherben in voller Lautstärke abspielen:
»Und wir schreien’s laut:
Ihr kriegt uns hier nicht raus!
Das ist unser Haus!«
Gentrifizierung für Anfänger
Ella Carina Werner
Deutschland, ein Land im Umbruch: Tausende Stadtviertel werden Opfer der Gentrifizierung. Millionen Alteingesessene verlieren ihre Existenz. Doch langsam regt sich Widerstand.
Es ist bereits die dritte Schließungswelle, die den Hamburger Stadtteil Eimsbüttel überrollt. Um das einstige Arbeiter- und Ausländerviertel steht es schlecht. Fast täglich macht ein Laden dicht. Auch heute. »Räumungsverkauf – alles muss raus!« steht in knalligen Lettern quer über der Eingangstür. Diesmal hat es das Druckfrisch , die traditionsreiche Fixerstube erwischt. »Am Ende waren die Fixkosten einfach zu hoch«, seufzt der betrübte Ladeninhaber und tritt gegen die Registrierkasse. Doch was tun, wenn die Stammkundschaft fortzieht?
Der hanseatische Stadtteil ist kein Einzelfall. Ob in Berlin-Prenzlauer Berg, Köln-Ehrenfeld oder Leipzig-Südvorstadt: Überall werden innenstadtnahe Wohnviertel umstrukturiert, restauriert, luxussaniert, arisiert oder kurz gesagt: gentrifiziert. Überall werden statusniedrige Bevölkerungsgruppen durch statushöhere verdrängt: Arme durch Reiche, Farbige durch Hautfarbene, einfache Menschen durch komplizierte und so fort.
Gentrifizierungsprozesse laufen nach typischen Mustern ab. Auch in Eimsbüttel. Bis vor wenigen Jahren war der Stadtteil ein malerisches Arbeiterviertel wie viele andere auch: abgelebte Gründerzeitbauten, Reih an Reih. Putz bröckelte von Hausfassaden. Stuck rieselte von Zimmerdecken. Ein paar Bumslokale mit Kohleöfen. Ein paar Spielhöllen mit schlecht saniertem Stuck. In den Eckkneipen gab’s Bier, Korn, Spezi oder ein paar aufs Maul. Die Menschen waren eher einfach verglast: Männer soffen. Frauen tratschten. Tauben balgten auf Balkonen. Kinder kackten von den Dächern. Und die Mieten waren billig wie das Bier.
Doch dann kamen die ersten Eindringlinge: Studenten, Künstler, Wehrdienstverweigerer und andere windige Typen, auf der Suche nach einer billigen Bleibe und etwas Aufmerksamkeit. Sie nannten sich die »Pioniere«. Sie drückten dem Viertel ihren Stempel auf. Sie sorgten mit lila Lavalampen und tragbaren Computern für einigen Wirbel. Sie tranken Spezi ohne Cola, sagten Tschüssi ohne Kowski, und auf ihren Klingelschildern stand nicht »Familie Jessen«, sondern »Seb, Caro, Iggi, Fetzifetz, DJ Dödel & Band«. Sie eröffneten bizarre Geschäfte: Waschsalon und Bar in einem, Dessousladen und Frittenbude, Kita und Schlachterei.
Und dann, plötzlich, kamen sie alle: Bürger, Banker, Besserverdiener, die nicht mehr wie die Maden im Speckgürtel hausen wollten und die Altmieter verdrängten. Wohin, weiß keiner so genau. Hinweise liefern lediglich ein paar messingfarbene »Stolpersteine«, eingelassen in die Gehwege vor den Hauseingängen. »Hier wohnte Günther ›Korni‹ Petersen, geb. 1949. Gedemütigt – vertrieben«, oder Ähnliches steht in winzigen Buchstaben darauf.
Und heute? Heute ist mit Eimsbüttel nicht mehr viel los. In den Mülltonnen verwaisen die Pfandflaschen. Im Park randaliert ein unterbeschäftigter Peacekeeper. Zwei Spielhöllen mussten bereits schließen. Im Mösengeschrei bleibt die Kundschaft aus. Der inhabergeführte Familienbetrieb steht kurz vor der Pleite.
»Wir haben den Laden längst aufgegeben«, gesteht auch der Direktor der örtlichen Hauptschule. Auf dem Schulhof steht die Insolvenzmasse ratlos herum. Auch in der Babyklappe herrscht Flaute. Die Nachfrage ist nicht das Problem. Fast stündlich sieht man eine gepflegte Endvierzigerin gegen die Scheibe hämmern. Doch es mangelt an Angebot. Selbst um den Ein-Euro-Laden steht es schlecht. Als Grund nennt der Geschäftsführer die wirtschaftliche Situation: »Die Menschen haben hier immer mehr in der Tasche«, ächzt er.
Wer hier als Händler überleben will, muss sich auf die neue Klientel einstellen. So wie Rita G., Kioskinhaberin in der dreiundzwanzigsten Generation. Sie hat kurzerhand ihr Sortiment umgestellt: Mehrlagiges Klopapier und Ritalin-Drops für die Kleinen gehen weg wie warme Semmeln. Im Fachgeschäft für Arbeitskleidung baumeln jetzt Richterroben, Doktorhüte, Dirigentenstöcke und Escort-Strings in gedeckten Farben. Auch Ali, der Lebensmittelhändler, hat die Zeichen der Zeit verstanden: Statt türkischer Grobkost vertreibt er jetzt deutsche Feinkost. »Man muss flexibel sein, sich anpassen«, weiß auch Fiete Paulsen. Der einst gefeierte Arbeiterdichter hat auf Bürgerliche Trauerspiele umgeschult.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Lost in Gentrification»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Lost in Gentrification» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Lost in Gentrification» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.