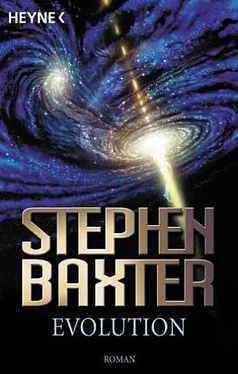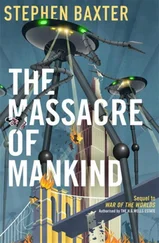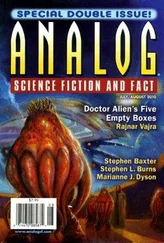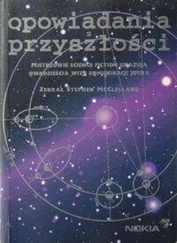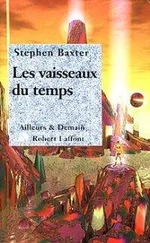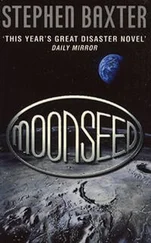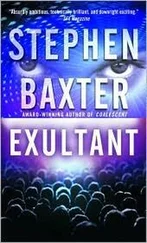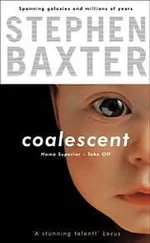So lief das immer. Damit überhaupt jemand zuhörte, musste man schreien.
Schließlich gab Kieselstein es auf und setzte sich keuchend in den Schmutz. Er hatte sein Bestes gegeben.
Plattnase kniete neben ihm nieder. Plattnase glaubte seinem Sohn: Die Vorführung hatte ihn zu sehr angestrengt, als dass er gelogen hätte. Er legte seinem Sohn die Hand auf den Kopf.
Beruhigt berührte Kieselstein den Arm seines Vaters. Er spürte eine Reihe langer und gerader Narben, die parallel zum Unterarm verliefen. Diese Kratzer stammten aber nicht von Tieren. Plattnase hatte sie sich mit der scharfen Klinge eines Steinmessers selbst zugefügt. Kieselstein wusste, wenn er älter war, würde er sich dem gleichen Spiel, der gleichen Selbstverstümmelung unterziehen, die man stumm und mit einem Grinsen erduldete: Sie war ein Teil dessen, was seinen Vater ausmachte, war Teil seiner Stärke, und Kieselstein empfand es als tröstlich, diese Narben zu streicheln.
Einer nach dem andern gesellten die Erwachsenen sich zu ihnen.
Als der Moment des stillschweigenden Einverständnisses verstrichen war, stand Plattnase auf. Es bedurfte keiner Worte mehr. Jeder wusste, was zu tun war. Die Erwachsenen und die älteren Kinder durchstreiften die Siedlung auf der Suche nach Waffen. Es herrschte keine Ordnung in der Siedlung, und die Waffen und anderen Werkzeuge lagen dort herum, wo man sie zuletzt benutzt hatte – inmitten von Haufen aus Nahrungsmitteln, Schutt und Asche.
Trotz der Dringlichkeit bewegten die Leute sich jedoch eher gemächlich, als ob sie die Wahrheit immer noch nicht so recht glauben wollten.
Staub, Kieselsteins Mutter, versuchte ihr quengelndes Baby zu beruhigen, während sie die Ausrüstung zusammensuchte. Das offene, vorzeitig ergraute Haar war in einer exzentrischen Anwandlung immer mit einem trockenen duftenden Staub gepudert. Mit fünfundzwanzig alterte sie schnell und hinkte wegen einer alten Wunde, die nie richtig verheilt war. Seither hatte Staub doppelt so hart gearbeitet, und diese Belastung spiegelte sich in ihrer gebückten Haltung und dem verhärmten Gesicht wider. Aber sie hatte einen klaren Verstand und eine außerordentliche Vorstellungskraft. Sie dachte schon an die schweren Zeiten, die bevorstanden. Beim Blick in ihr Gesicht fühlte Kieselstein sich schuldig, weil er sie mit dieser Sache behelligt hatte…
Kieselstein hörte ein leises Zischen, sah einen Blitz. Er drehte sich um.
In einem traumgleichen Moment sah er den Speer im Flug. Er war aus einem schönen Stück Hartholz gearbeitet. Vor der Spitze war er am dicksten und verjüngte sich zum Ende hin, was ihm gute Flugeigenschaften verlieh.
Und dann war es, als ob die Zeit wieder in Fluss geriet.
Der Speer bohrte sich Plattnase in den Rücken. Er wurde auf den Boden geschleudert. Der Speer ragte ihm senkrecht aus dem Rücken. Er zuckte noch einmal und entlud explosiv den Darm. Eine schwarzrote Pfütze breitete sich unter ihm aus und tränkte den Boden.
Im ersten Moment war Kieselstein mit diesen Eindrücken überfordert – mit der Vorstellung, dass Plattnase so plötzlich gestorben war. Es war, als ob ein Berg plötzlich verschwunden oder ein See verdampft wäre. Doch Kieselstein hatte den Tod trotz seines jungen Lebens schon in allen Facetten kennen gelernt. Und er roch auch den Gestank nach Kot und Blut: Fleisch riecht, aber keine Person.
Ein Fremder stand zwischen den Hütten. Er war kompakt und kräftig. Er war in Häute gewickelt und hielt einen Stoßspeer in der Hand. Sein Gesicht war ockerfarbenen schraffiert. Er war derjenige, der Plattnase mit dem Speer niedergestreckt hatte. Und Kieselstein sah auch den zurückgelassenen Grabstock in der Hand des Fremden. Sie hatten ihn beim Maniokstrauch gesehen. Sie waren seiner Spur gefolgt. Kieselstein hatte sie hierher geführt.
Voller Wut, Furcht und Schuldgefühl rannte er los.
Doch er kam nicht weit. Seine Mutter hatte ihn an der Taille festgehalten. Auch wenn sie hinkte, war sie immer noch stärker als er, und sie schaute ihn plappernd an. »Dumm! Dumm!« Für einen Moment wurde Kieselstein wieder klar im Kopf. Nackt und unbewaffnet wie er war, wäre er sofort getötet worden.
Ein Mann kam aus der Siedlung gerannt. Er war nackt und hatte einen Stoßspeer. Er war Kieselsteins Onkel und stürzte sich auf den Mörder seines Bruders. Der Fremde wehrte den ersten Schlag ab, doch der Gegner riss ihn um. Die beiden gingen zu Boden, rangen miteinander und versuchten jeweils den entscheidenden Schlag oder Stoß anzubringen. Bald waren sie in einer Staubwolke verschwunden. Sie waren zwei Muskelpakete, die sich mit aller Kraft bekämpften. Es war wie ein Kampf zwischen zwei Bären.
Und nun quollen immer mehr Jäger über die Felskante und aus dem Wald. Männer und Frauen gleichermaßen, alle mit Speeren und Äxten bewaffnet. Sie waren schmutzverkrustet, mager und hatten einen harten Blick. Sie waren über Kieselstein und seine Gruppe gekommen, als sei sie eine ahnungslose Antilopenherde.
Kieselstein sah die Verzweiflung in den Augen der anderen. Diese Neuankömmlinge waren genauso wenig Nomaden oder instinktgetriebene Eroberer, wie Kieselsteins Leute welche gewesen wären. Nur eine schlimme Katastrophe konnte sie dazu veranlasst haben, auf Wanderschaft zu gehen, sich in ein neues, unbekanntes Land zu wagen und diesen plötzlichen Krieg zu führen. Doch wo sie nun einmal hier waren, würden sie auf Leben und Tod kämpfen, denn sie hatten keine andere Wahl.
Plötzlich ertönte ein Geheul. Der Jäger, der mit seinem Onkel gekämpft hatte, war wieder aufgestanden. Ein Arm baumelte blutig und gebrochen herab. Aber er grinste – der Mund war eine blutige Masse mit ausgeschlagenen Zähnen. Kieselsteins Onkel lag mit aufgeschlitzter Brust auf dem Boden.
Kieselsteins Leute hatten bereits zwei der drei Männer verloren: Plattnase und seinen Bruder. Sie standen auf verlorenem Posten.
Die Überlebenden ergriffen die Flucht. Es blieb ihnen keine Zeit, etwas mitzunehmen; keine Werkzeuge, keine Nahrung und nicht einmal die Kinder. Und die Jäger griffen sie auch noch auf der Flucht an und brachten sie mit dem stumpfen Ende der Speere zu Fall. Der dritte Mann wurde niedergestreckt. Die Jäger erwischten zwei Frauen und ein Mädchen, das jünger war als Kieselstein. Die Frauen wurden zu Boden geworfen, und die jungen Männer zogen ihnen die Beine auseinander und versuchten sich bei der Vergewaltigung zuvorzukommen.
Die Übrigen rannten immer weiter, bis die Verfolger schließlich aufgaben.
Kieselstein schaute den Weg zurück, den sie gekommen waren. Die Jäger durchsuchten die Siedlung und gingen dabei auf einem Boden umher, der seit undenklichen Zeiten Kieselsteins Stamm gehört hatte.
Dann sah Kieselstein, dass nur noch fünf Dorfbewohner übrig waren. Zwei Frauen, einschließlich seiner Mutter, Kieselstein selbst, ein kleineres Mädchen und ein Baby – es war aber nicht Kieselsteins Schwester. Nur fünf.
Mit versteinertem Gesicht wandte Staub sich an Kieselstein und legte ihm die Hand auf die Schulter. »Mann«, sagte sie bedeutungsschwer. »Du.«
Das stimmte, wie er schreckerfüllt feststellte. Er war das älteste überlebende Mitglied des Stamms. Von den Fünf war nur noch das quengelnde Baby im Schmutz zu seinen Füßen männlichen Geschlechts.
Staub hob das mutterlose Baby auf und drückte es an sich. Dann kehrte sie der Heimat den Rücken und stapfte Richtung Norden, wobei sie mit dem hinkenden Gang unregelmäßige Spuren im Schmutz hinterließ.
Der ebenso verwirrte wie entsetzte Kieselstein folgte ihr.
Das Pleistozän, diese Eiszeit, war ein Zeitalter brutaler Klimaschwankungen. Dürre, Überschwemmungen und Stürme waren normale Erscheinungen. In dieser Periode ereignete sich eine ›Jahrhundertkatastrophe‹ alle zehn Jahre. Es war eine Zeit wilder Schwankungen, eine Zeit, in der das Klima Kapriolen schlug.
Читать дальше