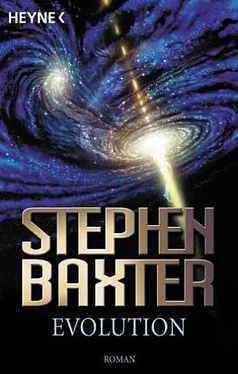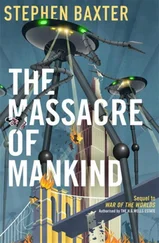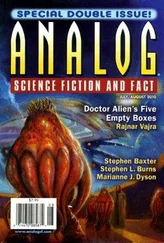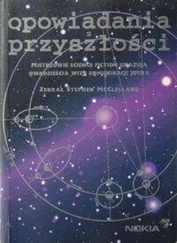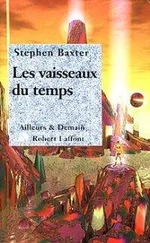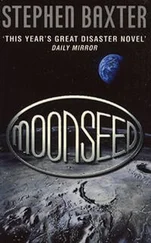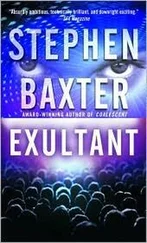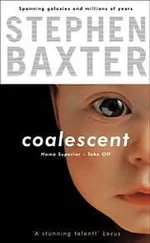Weißblut saß keuchend über dem Schauplatz dieser Attacke. Vom Dickbauch war nichts mehr übrig außer einem Haufen dünnen, übel riechenden Kots und einer Handvoll zerstampfter Blätter. Allmählich schloss die Lücke im Floß sich wieder, als ob es sich selbst heilte. Die Anthros kauerten sich zusammen. Sie waren sogar zu mitgenommen, um sich zu kämmen.
Und die Sonne stieg am westlichen Himmel hinab – in der Richtung, in die sie hilflos trieben.
Die Tage und Nächte folgten endlos aufeinander. Es war nichts zu hören außer dem Knarren der Äste und dem leisen Plätschern der Wellen.
In den Nächten hing ein erdrückender Himmel über ihnen, vor dem Streuner sich am liebsten verkrochen hätte.
Doch im Licht des Tages, unter der grellen Sonne oder grauen Wolken, sah sie nichts außer dem Meer. Es gab weder Wald noch Land oder Hügel. Sie roch nichts außer Salz, und es drangen weder die Rufe von Vögeln oder Primaten noch das Trompeten von Pflanzenfressern an ihr Ohr. Das Wasser der Flussmündung hatte sich inzwischen mit dem Meerwasser vermischt, und selbst der Schutt, der vom schrecklichen Sturm ins Meer gespült worden war, hatte sich zerstreut und driftete hinterm Horizont seinem Schicksal entgegen.
Das Floß selbst war leer geworden.
Die Anthracothere-Kadaver, die in den Ästen des Mango-Baums festgesteckt hatten, waren längst verschwunden. Der letzte Rostrote war auch nicht mehr da. Vielleicht war er ins Meer gefallen. Das Indricotherium war angeschwollen, während die Bakterien in seinen Gedärmen sich nach draußen fraßen. Doch die unsichtbaren Münder des Meers hatten sich auch am Indricotherium zu schaffen gemacht und fraßen es von unten auf. Nachdem er immer mehr Fleisch verloren hatte, war der mächtige Kadaver schließlich zusammengefallen und ins Meer gerutscht.
Die Anthros hatten längst alle Früchte verzehrt.
Sie versuchten das Laub zu essen. Anfangs gewannen sie daraus wenigstens einen Mund voll Wasser, das für eine Weile den Durst stillte. Aber der entwurzelte Baum war tot, und die restlichen Blätter verschrumpelten bald. Und anders als der unglückliche Dickbauch vermochten die Anthros eine so grobe Nahrung auch nicht zu verdauen, und sie verloren in dem wässrigen Kot, den sie ausschieden, nur noch mehr Flüssigkeit.
Streuner war ein kleines Tier, das für ein Leben in der Sicherheit des Waldes geschaffen war, wo es Nahrung und Wasser im Überfluss gab. Im Gegensatz zu einem Menschen, dessen Körper dafür ausgelegt war, eine lange Zeit im Freien zu überleben, hatte sie nur sehr wenig Fett, das die Haupt-Brennstoffreserve eines Menschen ist. Streuners Zustand verschlechterte sich zusehends. Bald wurde ihr Speichel dick und schmeckte faulig. Die Zunge klebte am Gaumen fest. Sie hatte starke Schmerzen in Kopf und Hals, weil die trocknende Haut sich zusammenzog. Die Stimme wurde brüchig, und sie schien einen harten, schmerzenden Knoten im Mund zu haben, der einfach nicht verschwinden wollte, so oft sie auch schluckte. Sie und die anderen Anthros hätten aber noch mehr gelitten, wenn der bewölkte Himmel die grelle Sonne nicht meistens ausgeblendet hätte.
Manchmal träumte Streuner. Der tote Mangobaum erblühte plötzlich, die Wurzeln bohrten sich wie Primatenfinger in den harten Meeresboden, die Blätter ergrünten und wedelten wie kämmende Hände, und dicke Fruchtstände zierten den Baum. Sie pflückte die Früchte, öffnete sie sogar und tauchte das Gesicht ins klare Wasser, mit dem jede Schale seltsamerweise gefüllt war. Und dann kamen ihre Mutter und Schwestern, wohlgenährt und voller Spannkraft und kämmten sie.
Doch dann verschwand das Wasser, als ob es in der heißen Sonne verdunstete, und sie wurde gewahr, dass sie nur an einem Stück Rinde oder einer Handvoll trockener Blätter kaute.
Fleck hatte einen Eisprung.
Weißblut machte als Alpha-Männchen dieser kleinen verlorenen Gemeinschaft schnell seinen Anspruch geltend. Weil sie nichts anderes zu tun hatten und auch nirgends hinzugehen vermochten, kopulierten Weißblut und Fleck oft – manchmal zu oft, und dann handelte es sich nur um eine ›Trockenübung‹ mit ein paar mechanischen Stößen.
Normalerweise wären wahrscheinlich auch Rangniedere wie die Brüder imstande gewesen, sich in diesen frühen Tagen des Eisprungs mit Fleck zu paaren. Weißblut, der aus einer Vielzahl potentieller Partnerinnen zu wählen vermochte, hätte sie erst dann vertrieben, wenn der Gipfel von Flecks Fruchtbarkeit nahte und damit die beste Chance, sie zu schwängern.
Das wäre nämlich auch in Flecks Interesse gewesen. Mit der Schwellung wollte sie möglichst viele Männchen auf ihre Fruchtbarkeit aufmerksam machen. Einmal bewirkte die daraus resultierende Konkurrenz eine hohe Qualität der Bewerber, ohne dass sie sich die Mühe machen musste, den Besten auszusuchen. Und wenn alle Männchen der Gruppe zur gleichen Zeit sich mit ihr paarten, vermochte sich keins sicher zu sein, wer denn nun der Vater eines Babys war. Deshalb riskierte ein Männchen, das versucht war, ein Baby zu töten, um den Fruchtbarkeits-Zyklus eines Weibchens zu beschleunigen, die Ermordung seines eigenen Nachwuchses. Die Schwellung, mit der sie den Eisprung ›publik‹ machte, war für Fleck also eine Möglichkeit, die Männchen um sie herum mit minimalem Aufwand zu kontrollieren und zugleich das Risiko eines Kindsmords zu verringern.
Allerdings gab es auf diesem kleinen Floß nur ein ausgewachsenes Weibchen, das Weißblut mit niemandem teilen würde. Also saßen Brille und Linkshänder zu Statisten degradiert nebeneinander und kauten auf Blättern herum, während die erigierten Penisse aus dem Fell stachen. Sie mussten sich damit begnügen, Flecks prächtige Schwellung zu bewundern. Jedes Mal, wenn sie eine Annäherung an Fleck versuchten oder sie gar zaghaft zu kämmen versuchten, geriet Weißblut in Rage, erging sich in Drohgebärden und attackierte den Vorwitzigen.
Was Streuner betraf, so wäre sie Fleck als Fremde immer untergeordnet. Dennoch war sie in dieser Ausnahmesituation Fleck schnell so nahe gekommen wie ihren Schwestern.
Wenn Weißblut und Fleck kopulierten, nahm Streuner sich oft Knäuel an. Nach ein paar Tagen hatte Knäuel Streuner als eine Tante ehrenhalber akzeptiert. Das kleine Gesicht des Babys war kahl, und es hatte ein olivfarbenes Fell, mit dem es sich deutlich von der Mutter abhob; es war eine Farbe, die bei Streuner und sogar bei den Männchen einen Beschützerinstinkt weckte. Manchmal spielte Knäuel allein und kletterte tapsig über die verflochtenen Äste, doch viel lieber wollte sie sich an Streuners Brust oder Rücken klammern oder von ihr im Arm gehalten werden.
Die Aufgabe der Kinderaufzucht teilten die Anthros sich – obwohl normalerweise nur Verwandte als Betreuer zugelassen waren.
Anthro-Kinder wuchsen viel langsamer als die Jungen aus Noths Ära, weil die Entwicklung der Gehirne mehr Zeit in Anspruch nahm. Obwohl die Anthro-Kinder im Vergleich zu den Menschenkindern bei der Geburt schon gut entwickelt waren, waren sie doch hilflos, schwach und völlig von der Mutter abhängig. Es war, als ob Knäuel ein Frühchen wäre und das embryonale Wachstum außerhalb des Mutterleibs abschloss.
Dadurch stand Fleck unter großem Druck. Achtzehn Monate lang musste eine Anthro-Mutter die täglichen Überlebens-Anforderungen mit den Pflichten der Kinderaufzucht unter einen Hut bringen – und sie musste sich auch noch die Zeit nehmen, ihre Schwestern, Artgenossinnen und potenzielle Paarungsgefährten zu kämmen. Schon bevor sie auf dem Floß gestrandet war, hatten diese Pflichten Fleck über Gebühr strapaziert. Aber in der Gesellschaft der Weibchen um sie herum hatten sich immer wieder ›Tanten‹ und Kindermädchen gefunden, die ihr das Kind abgenommen und eine Ruhepause ermöglicht hatten. Streuners Hilfe entlastete Fleck, zumal Streuner auch ihre Freude daran hatte. Außerdem bereitete sie sich so auf ihre eigene Mutterrolle vor. Und sie hatte reichlich Zeit zum Kämmen.
Читать дальше