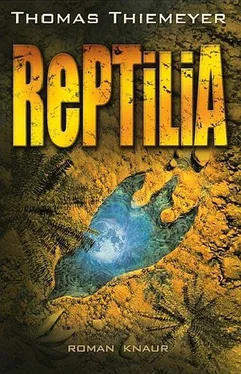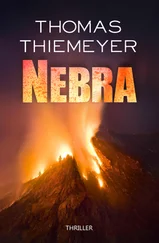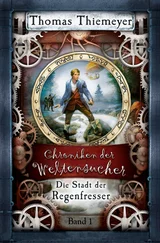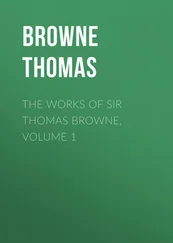Donner drang nur noch als schwaches Echo an seine Ohren.
Zeit sich zu beeilen, wollte er die Spur nicht verlieren. Die Abdrücke begannen sich durch das Aufquellen des Bodens bereits zu verformen. Bald würden sie vollständig verschwunden sein.
Er spurtete durch den Wirrwarr von abgerissenen Blättern und zerbrochenen Ästen, die der Sturm aus den Baumkronen gefegt hatte, während er sich bemühte, seine Deckung nicht zu vernachlässigen. Mit der Zeit wurde ihm jedoch klar, dass er sich keine Sorgen zu machen brauchte. Das Unwetter schien die Bewohner des Waldes verschreckt zu haben. Sämtliche Tiere, die normalerweise die Baumwelt bevölkerten, waren verstummt. Egomo konnte das nur recht sein, denn er musste nicht mehr befürchten, in einen Hinterhalt zu geraten, und kam viel schneller voran.
Etwa eine halbe Stunde später bemerkte er, wie sich der Wald zu lichten begann. Erst vereinzelt, dann immer deutlicher entstanden Lücken im Blätterdach, durch die das Licht eines stumpfgrauen Himmels drang. Nur noch wenige Schritte und er hatte die Waldgrenze erreicht. Er blieb stehen und verschnaufte. Vor ihm breitete sich eine endlose Grasfläche aus. Der Saum des Waldes, der wie eine grüne Palisade wirkte, verlor sich irgendwo in der trüben und mit Feuchtigkeit gesättigten Ferne.
Egomo beschirmte seine Augen. Der plötzliche und starke Lichteinfall blendete ihn. Nein, entschied er innerlich, er mochte diese Gegend nicht. Sie war fremd und voller Gefahren. Nicht wie eine Bai, eine von diesen kleinen, überschaubaren Lichtungen, auf denen sich vorzugsweise Elefanten oder Gorillas tummelten. Auch nicht wie der Lac Tele, bei dem es sich ja immerhin um eine Wasserfläche handelte. Dies hier war anders. Es gab keinen Grund dafür, warum der Wald hier plötzlich endete.
Egomo seufzte. Die Spur oder das, was von ihr übrig geblieben war, verlief schnurgerade hinein in das Gras, weg von der schützenden Dunkelheit des Waldes. Dorthin konnte und wollte er ihr nicht folgen. Es war zu bedrohlich, denn es war das Jagdgebiet der Hyänen, Wildhunde und Leoparden, die sich zwischen den mannshohen Grasstauden verbargen und alles angriffen, was dumm genug war, sich in das Labyrinth vorzuwagen.
Er machte es sich auf dem Boden bequem und öffnete seinen Proviantbeutel. Darin befand sich neben einer ledernen Trinkflasche, ein paar Feigen, Zwergdatteln, Muskatblüten und etwas getrocknetem Affenfleisch auch alles, was er brauchte, um ein Feuer zu entzünden: ein Stück Eisen, Flintstein und getrocknete Zunderpilze.
Aber was sollte er jetzt essen? Er entschied sich für die Feigen und hob das zähe Fleisch für später auf. Er mochte es ohnehin nicht besonders, denn es schmeckte muffig. Wenn er ehrlich war, mochte er Fleisch nur frisch gebraten von der Feuerstelle. Schon beim Gedanken daran lief ihm das Wasser im Mund zusammen, und während er auf einer süßen Feige herumkaute, ent-schied er, dass es heute Abend Frischfleisch geben sollte. Mokele m'Bembe hin oder her, er hatte jetzt lange genug von Trockennahrung gelebt. Außerdem hatte er vor, sich für seinen Mut zu belohnen. Es sollte aber ein wirkliches Festmahl werden. Eine Meerkatze oder ein Pinselohrschwein durfte es schon sein. Mit dem Gedanken an diese Delikatessen beendete er seine Rast, trank noch rasch einen Schluck und richtete sich auf. Er würde dem Saum des Waldes folgen und sehen, wohin er ihn führte. Wenn er Glück hatte, würde er das Ungetüm irgendwo entdecken. Groß genug war es ja. Was er dann tun sollte, konnte er immer noch entscheiden, wenn es so weit war. Erlegen würde er es sicher nicht, aber vielleicht fand er eine Klaue oder Schuppe, die er als Trophäe mit nach Hause bringen konnte. Was wäre das für ein Verlobungsgeschenk!
Leichtfüßig machte er sich auf den Weg und folgte dem Waldrand nach rechts. Das Gelände war dort übersichtlicher und nicht so zugewuchert. Er war noch nicht weit gelaufen, als er einen merkwürdigen Geruch wahrnahm.
Rauch!
Schnuppernd hielt er die Nase in die Luft und versuchte herauszufinden, aus welcher Richtung der Wind kam. Das Feuer lag genau in der Richtung, in die er wollte. Egomo prüfte seine Armbrust, in die immer noch ein Pfeil gespannt war, dann pirschte er sich vorwärts. Lautlos, Schritt für Schritt, alle Sinne aufs Äußerste gespannt.
Je näher er dem Brandherd kam, desto deutlicher wurde ihm bewusst, dass dies kein normales Feuer war. Verbranntes Holz roch anders, genau wie Blätter und Gräser. Auch verbranntes Fleisch hatte einen anderen Geruch. Es roch wie ... wie ...
Egomo erschrak. Es roch wie das verwüstete Lager am See. Doch diesmal war der Brandgeruch frisch und beißend. Er erinnerte sich an die verkohlten Kunststoffteile, die Kabel, die halb vergraben im Uferschlamm lagen, das zersplitterte Glas. Kalter Schweiß trat ihm auf die Stirn. Er fühlte, dass er dem Ziel sehr nahe war.
Nur widerwillig trugen ihn seine Füße vorwärts. Jeder Muskel in seinem Körper war gespannt, bereit, beim geringsten Anzeichen einer Bedrohung die Flucht zu ergreifen. Er konnte bereits dünne Rauchschwaden erkennen, die etwa dreißig Meter von ihm entfernt zwischen den mannshohen Grasbüscheln aufstiegen. Wäre er doch bloß größer, dann könnte er sehen, was da vor ihm lag. So aber war er praktisch blind. Wie ein Kind mit verbundenen Augen tastete er sich voran, mitten hinein in etwas, was ihn das Leben kosten konnte. Trotzdem wollte er jetzt nicht stehen bleiben. Er musste einfach sehen, was dort lag, musste endlich erfahren, was geschehen war. Nur noch ein paar Meter . langsam . langsam.
Und dann sah er es.
Es dauerte einen Moment, bis er begriff. Seine Augen weiteten sich vor Entsetzen, als er immer neue schreckliche Einzelheiten erkannte.
Egomo schlug die Hände vor den Mund und fiel auf die Knie. Die Armbrust rutschte über seine Schulter zu
Boden und der Proviantbeutel entglitt seinen zitternden Händen. Nie zuvor hatte Egomo etwas so Erschütterndes gesehen. Er verfluchte sich für seine Neugier. Warum hatte er nicht aufgegeben? Warum war er nicht heimgekehrt zu seiner Familie und seinen Freunden?
Obwohl sein Magen beim Anblick der vielen Toten rebellierte, begann sein verwirrter Verstand zu überlegen, was hier geschehen sein mochte. Waren dies die Leichen der weißen Frau und ihrer Männer? Nein, eindeutig nicht. Dies hier waren die Körper von Soldaten, er erkannte es an den zerfetzten Uniformen, den verbogenen Waffen und den markanten Lederstiefeln. Ihr Profil entsprach genau dem Abdruck, den er am Ufer des Sees gefunden hatte. Um sich zu vergewissern, hob er einen davon hoch, ließ ihn aber sofort wieder fallen, als er den Fuß bemerkte, der immer noch darin steckte. Was für ein grauenvoller Ort. War dies das Werk von Mokele m'Bembe? Wenn ja - was für eine gnadenloses Raubtier hauste da in den Tiefen des Wassers? Es schien noch um vieles schlimmer zu sein als in den Erzählungen.
Plötzlich bemerkte er eine Bewegung am Rande seines Sichtfelds. Eine der zerstückelten Leichen bewegte sich. Egomo glaubte zunächst an einen Irrtum. Doch dann hörte er ein Wimmern. Ein Überlebender.
Vor Grauen fast gelähmt, näherte sich Egomo dem zerfetzten Körper. Den süßlichen Geruch von frischem Blut und verbranntem Fleisch nahm er kaum noch wahr. Er musste seine ganze Willenskraft aufbringen, um sich nicht zu übergeben, während er über die he-rumliegenden Leichenteile stieg. Plötzlich sah er, was sich da bewegte. Ein gelblicher Kopf, zwei helle Augen mit senkrechten Pupillen und ein erschreckend weißes Gebiss.
Der Leopard, in dessen blutverschmierter Schnauze ein halber Unterarm hing, ließ ein kurzes Grollen hören, ehe er sich geschmeidig umdrehte und im hohen Gras verschwand. Egomo verfluchte sich für seine eigene Dummheit. Wie hatte er das bloß vergessen können? Der frische Aasgeruch würde über kurz oder lang sämtliche Raubtiere der nahen Umgebung anlocken. Merkwürdig, dass sich nicht schon viel mehr Tiere zum gemeinsamen Festessen eingefunden hatten. Er befand sich hier in höchster Gefahr und musste so schnell wie möglich verschwinden.
Читать дальше