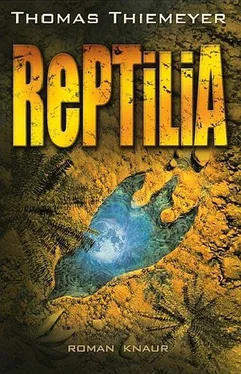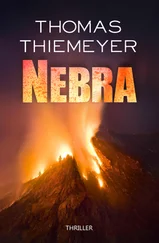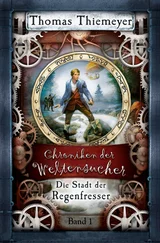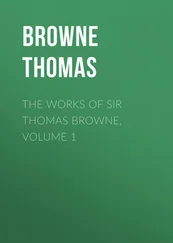Jäger, dachte er. Weiße Jäger. Nur sie konnten so unvorsichtig sein, bei ihrer Suche nach Beute den halben Urwald abzufackeln. War das die weiße Frau gewesen, die durch sein Dorf gezogen war? Hatte sie ihn nicht immer wieder nach dem See gefragt? Möglich war es, denn schließlich hatte sie alles darüber wissen wollen. Wie lang er war, wie breit und wie tief. Vor allem hatte sie wissen wollen, was in dem See war. Doch darüber durfte er nicht sprechen. Schon gar nicht mit einem Weißen. Das brachte Unglück.
Als er jetzt zwischen der Asche auf die Überreste eines Lagers stieß, wurde ihm klar, dass das Unglück bereits begonnen hatte.
Er stocherte mit dem Schaft seiner Armbrust in der schwarzen Erde. Überall fanden sich Glassplitter und verkohlte Kunststoffreste, dazwischen verbogene Eisenstangen und Stofffetzen. Egomo hatte so etwas noch nie gesehen. Etwas Furchtbares musste hier geschehen sein. Später stieß er auf etwas, das ihm merkwürdig vorkam. Er entdeckte einige Stellen, an denen zuvor Gegenstände gelegen hatten. Abdrücke, die von dem aufgeschwemmten Boden noch nicht vollständig wieder aufgefüllt worden waren.
Jemand war hier gewesen. Dieser Jemand hatte nach etwas gesucht und es mitgenommen. Was das gewesen sein mochte, darüber konnte Egomo nichts sagen. Jetzt glaubte er auch Fußspuren zu sehen. Sie waren alt, aber man konnte sie eindeutig erkennen, wenn man gezielt nach ihnen suchte. Er strich mit dem Finger über die Ränder. Es waren Abdrücke, wie sie nur von schweren
Stiefeln hinterlassen wurden. Ein Schauer kroch über seinen Rücken, als er sich erinnerte, woher er diese Stiefel kannte. Von Zeit zu Zeit kamen Männer durch sein Dorf. Böse Männer. Sie raubten ihre Nahrung und vergewaltigten ihre Frauen. Diese Männer trugen solche Stiefel.Soldatenstiefel.
Er richtete sich auf und ließ seinen Blick schweifen. Er hatte seine Pläne geändert. Der Zwergelefant musste warten. Erst musste er herausfinden, was hier geschehen war.
Eine unerklärliche Angst kroch seinen Rücken empor, als er sich dem See zuwandte und auf die spiegelglatte Wasserfläche hinausblickte. Das Wasser lag still und ruhig unter dem azurblauen Himmel. Irgendetwas war dort und beobachtete ihn, das spürte er.
Montag, 8. Februar Ganesha's Temple
V or dem Restaurant warteten bereits etliche Menschen darauf, eingelassen zu werden. Wie so oft am Abend war das Lokal voll, doch ich machte mir keine Sorgen, denn ich hatte sicherheitshalber einen Tisch reserviert. Wer in Ganesha's Temple essen wollte, musste darauf gefasst sein, abgewiesen zu werden, denn das Lokal war weit über South Kensington hinaus für seine exzellente indische Küche bekannt.
Ich schob mich an den Wartenden vorbei in den Eingangsbereich und wurde sogleich von Sahir, dem korpulenten Wirt, empfangen. Sahir war ein Sikh, er trug den traditionellen Turban und einen üppigen Vollbart. Er umarmte mich stürmisch und schüttelte mir die Hand. Als Stammgast hatte ich das Privileg, von ihm persönlich an den Tisch geführt zu werden. Ich muss gestehen, dass ich die neidischen Blicke der anderen Gäste genoss.
»David, mein Freund, es ist lange her, dass du mein Gast warst. Komm, setz dich. Ich habe dir einen besonders schönen Platz freigehalten. Isst du allein?«
»Nein, Sarah wird auch kommen.«
»Aaah, Sarah!«, er zwinkerte vergnügt. »Ihr wart schon lange nicht mehr bei mir. Seit wann seid ihr wieder zusammen?« Die Glöckchen in seinem Haar klingelten munter, und ich fragte mich, woher Sahir so genau Bescheid wusste. Hatte diese Stadt nichts Besseres zu tun, als Gerüchte zu verbreiten?
»Wir sind gar nicht ...«, begann ich, aber er hörte schon nicht mehr zu, denn in diesem Augenblick öffnete sich die Tür, und Sarah betrat das Restaurant. Sahir stürmte auf sie zu, und sein Interesse an mir war von einer auf die andere Sekunde erloschen. Als sie an den Tisch trat und ihren Mantel ablegte, ging ein Raunen durch das Restaurant. Sarah trug ein rotes Kleid mit einem atemberaubenden Dekollete, die gewagtesten Stöckelschuhe Londons und schwarze Satin-Handschuhe, die bis zu den Ellenbogen reichten. Mit einem Seufzer ließ ich mich in meinen Stuhl sinken. Alles, was ich wollte, waren ein gemütlicher Abend und ein ungezwungenes Gespräch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Doch mit Sarah in diesem Aufzug war das ein Ding der Unmöglichkeit. Sie schien es geradezu darauf anzulegen, mir wieder einmal vor Augen zu führen, was ich doch für ein gottverdammter Dummkopf war.
Sahir gab den vollendeten Gentleman. Flirtend und Komplimente verteilend, umschwirrte er sie wie eine fette Hummel den Blütenkelch. Er zog ihr den Stuhl vor, nahm ihr den Mantel ab und zündete die Kerze an unserem Tisch an. Dann beugte er sich vor und berich-tete uns mit verschwörerischer Miene von den Schätzen, die er in der Küche versteckt hielt.
»Wenn ich euch einen Tipp geben darf. Es gibt ein wunderbares Tandoori Chicken Masala, aber nicht irgendein Tandoori, oh nein. Die Hühnchen sind so zart, dass sie auf der Zunge zergehen.« Er verdrehte die Augen. »Ein Gedicht.«
»Klingt gut«, pflichtete ich ihm bei, und da auch in Sarahs Augen die Gier aufleuchtete, sagte ich: »Nehmen wir. Zweimal.«
»Ein wenig Brinjal Bhaji vorneweg?«
»Unbedingt. Und bitte mit reichlich Chapatis.« Sahir war berühmt für seine fantastischen Vorspeisen, und es gilt als Todsünde, darauf zu verzichten.
Er nickte zufrieden. »Aperitif?«
»Champagner«, lächelte Sarah. »Den besten. Mein Freund zahlt heute.«
»Das heißt, ich kann mir hinterher zum Essen nur noch ein dünnes Lager leisten«, ergänzte ich zähneknirschend.
Laut lachend entfernte sich Sahir, während ich vorsichtshalber nach meinem Portemonnaie tastete. Sarah schien sich in den Kopf gesetzt zu haben, mich wie eine Weihnachtsgans auszunehmen. Doch das war in Ordnung, schließlich stand ich in ihrer Schuld, und diese Einladung sollte unser Beziehungskonto etwas ausgleichen.
»Erzähl mal«, sagte sie, während sie ihre Handschuhe abstreifte. »Hat alles geklappt mit den Impfungen?«
Ich nickte. »Ich bin vollgedröhnt bis unter die Hals-krause. Als ich denen im Tropeninstitut verraten habe, wohin die Reise geht, schienen sie mir von allem die doppelte Ration geben zu wollen. Außerdem haben sie mich gefragt, ob ich noch alle Tassen im Schrank hätte. Kongo?, tobte der Chefarzt. Sind Sie lebensmüde? Was in Gottes Namen wollen Sie im Kongo?
Arbeiten, habe ich geantwortet. Dann suchen Sie sich hier eine Arbeit, hat er gewettert. Unsere Wirtschaft ist zwar am Boden, aber so schlecht geht es uns auch wieder nicht, dass wir für eine Beschäftigung in den Kongo fliegen müssten. Und so weiter. Du kannst dir vorstellen, wie das gelaufen ist.«
»Lebhaft«, lächelte sie und griff nach dem Champagner, den Sahir soeben vor ihr platziert hatte. »Auf dein Wohl.«
»Auf deines.« Der Champagner war ausgezeichnet und vertrieb die düsteren Gedanken, die mich den ganzen Nachmittag lang verfolgt hatten.
Sarah stellte das Glas ab und schmatzte genießerisch. »Das habe ich gebraucht. Und jetzt erzähl mal: Hast du etwas herausgefunden über den Kongo?«
»Herzlich wenig. Bevölkerungszahl, Fläche, Wirtschaft. Alles uninteressant. Auch die Buchhandlungen scheinen diesen Teil Afrikas komplett aus ihrem Programm genommen zu haben. Keine Reiseführer, keine Bildbände, keine Karten, nichts. Es ist, als würde dieses Land nicht existieren.«
»Das liegt sicher daran, dass es für Reisende uninteressant ist«, entgegnete sie. »Keine Touristen, keine Reiseführer. Hast du mal in der Zentralbibliothek nachgefragt?«
»Schon, aber da gibt es nur Berichte, die über zwanzig Jahre alt sind. Ich brauche aber aktuelle Informationen.« Ich zuckte mit den Schultern. »Hoffentlich hat Maloney sich gut vorbereitet. Ich hasse es, irgendwohin zu fliegen, ohne zu wissen, was mich erwartet.«
Читать дальше