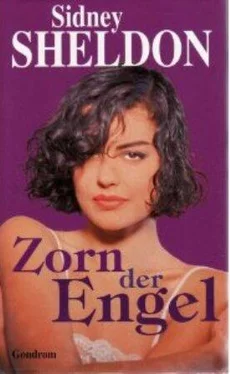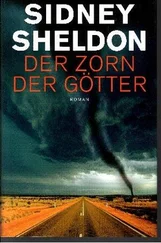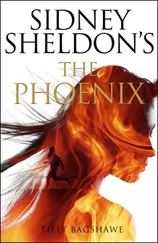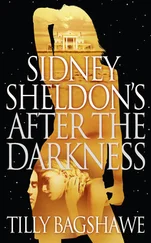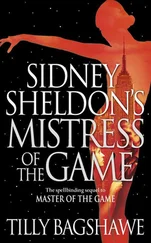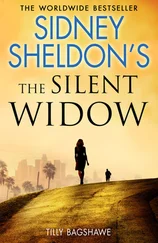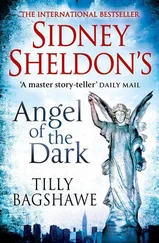Es hatte zu regnen begonnen. Jennifer blickte zum Himmel und fragte sich, ob Gott für sie weinte.
Ken Bailey war der einzige Mensch, an den Jennifer sich um Hilfe wenden konnte.
»Ich muß eine Abtreibung machen lassen«, sagte sie ohne Einleitung. »Kennst du irgendeinen guten Arzt?« Er versuc hte, seine Reaktion zu verbergen, aber Jennifer konnte den Widerschein einer Vielzahl von Gefühlen auf seinem Gesicht sehen.
»Irgendwo außerhalb der Stadt, Ken. An einem Ort, wo man mich nicht kennt.«
»Wie wäre es mit den Fidschi-Inseln?« Seine Stimme klang zornig.
»Ich meine es ernst.«
»Entschuldige. Ich... du hast mich einfach überrascht.« Die Neuigkeit hatte ihn völlig umgeworfen. Er verehrte Jennifer. Er wußte, daß er sie gern hatte, und es gab Zeiten, in denen er sie zu lieben glaubte; aber er war nie sicher, und das quälte ihn. Mit Jennifer könnte er niemals das tun, was er mit seiner Frau gemacht hatte. Gott, dachte Ken, warum, zum Teufel, konntest du dich ausgerechnet bei mir nicht entscheiden? Er fuhr sich mit den Händen durch das rote Haar und sagte: »Wenn du es nicht in New York gemacht haben willst, dann würde ich Nordcarolina vorschlagen. Das ist nicht so weit weg.«
»Kannst du mir dort etwas suchen?«
»Ja, sicher. Ich...«
»Ja?«
Er sah weg. »Nichts.«
Die nächsten drei Tage war Ken Bailey verschwunden. Als er am vierten Tag in Jennifers Büro kam, war er unrasiert, und seine Augen lagen tief in den Höhlen und hatten rote Ränder. Jennifer warf nur einen Blick auf ihn und fragte: »Geht es dir gut?«
»Ich glaube, schon.«
»Kann ich irgend etwas für dich tun?«
»Nein.« Wenn Gott mir schon nicht helfen kann, Liebes, dann kannst du es noch weniger.
Er gab Jennifer einen Zettel. Darauf stand: Dr. Eric Linden, Memorial Hospital, Charlotte, Nordcarolina. »Ich danke dir, Ken.«
»De nada. Wann willst du es machen lassen?«
»Ich werde dieses Wochenende hinfahren.«
Verlegen fragte er: »Soll ich mitkommen?«
»Nein, danke. Ich schaff's schon allein.«
»Und die Rückfahrt?«
»Ich schaffe es.«
Er zögerte noch einen Moment, ehe er ging. »Es geht mich ja nichts an, aber bist du sicher, daß du das Richtige tust.«
»Ja. Ich bin sicher.«
Sie hatte keine Wahl. Nichts auf der Welt wünschte sie sich mehr, als Adams Baby behalten zu können, aber sie wußte, daß es Wahnsinn wäre, das Kind allein großzuziehen.
Sie blickte Ken an und sagte noch einmal: »Ich bin sicher.« Das Hospital war ein freundlich aussehendes, altes, zweistöckiges Ziegelgebäude in den Außenbezirken von Charlotte. An der Pforte saß eine grauhaarige, etwa sechzigjährige Frau. »Kann ich Ihnen helfen?«
»Ja«, sagte Jennifer. »Ich bin Mrs. Parker. Ich habe einen Termin bei Dr. Linden für - für...« Sie konnte die Worte nicht über ihre Lippen bringen.
Die Frau nickte verständnisvoll. »Der Doktor erwartet Sie, Mrs. Parker. Ich hole jemanden, der Ihnen den Weg zeigt.« Eine tüchtige junge Schwester führte Jennifer zu einem Untersuchungsraum am Ende des Flurs. »Ich sage Dr. Linden, daß Sie hier sind. Würden Sie sich schon einmal ausziehen? Auf dem Bügel hängt ein Krankenhemd.«
Langsam zog Jennifer sich aus und legte das weiße Klinikgewand an. Ein Gefühl von Unwirklichkeit erfüllte sie. Sie kam sich vor, als binde sie eine Metzgerschürze um. Sie stand kurz davor, das Leben in ihrem Schoß zu töten. Sie sah Blutspritzer auf der Schürze, das Blut ihres Babys. Sie begann zu zittern. Eine Stimme sagte: »Aber, aber. Entspannen Sie sich.« Jennifer blickte auf und sah einen stämmigen, kahlköpfigen Mann mit einer horngerahmten Brille, die seinem Gesicht einen eulenhaften Ausdruck gab.
»Ich bin Dr. Linden.« Er blickte auf die Karte in seiner Hand. »Sie sind Mrs. Parker.« Jennifer nickte. Der Doktor berührte ihren Arm und sagte beruhigend: »Setzen Sie sich.« Er ging zum Waschbecken und füllte einen Pappbecher mit Wasser. »Trinken Sie das.« Jennifer gehorchte. Dr. Linden saß in seinem Stuhl und beobachtete sie, bis das Zittern aufgehört hatte. »So. Sie wollen also eine Abtreibung durchführen lassen.«
»Ja.«
»Haben Sie darüber mit Ihrem Mann gesprochen?«
»Ja. Wir... wir wollen es beide.«
Er studierte sie. »Sie scheinen gesund zu sein.« «
»Es... es geht mir gut.«
»Ist es ein wirtschaftliches Problem?«
»Nein«, sagte Jennifer scharf. Warum behelligt er sie mit diesen Fragen? »Wir... wir können es einfach nicht bekommen.« Dr. Linden förderte eine Pfeife zutage. »Stört es Sie, wenn ich rauche?«
»Nein.«
Dr. Linden zündete die Pfeife an und sagte: »Dumme Angewohnheit.« Er lehnte sich zurück und paffte ein paar Rauchwolken in die Luft.
»Können wir es nicht endlich hinter uns bringen?« Ihre Nerven waren bis zum äußersten gespannt. Sie fühlte, daß sie jeden Augenblick zu schreien beginnen könnte. Dr. Linden zog noch einmal lang an seiner Pfeife. »Ich glaube, wir sollten uns ein paar Minuten unterhalten.« Mit übermenschlicher Willenskraft beherrschte Jennifer ihre Ungeduld. »Wie Sie meinen.«
»Das Dumme an Abtreibungen«, sagte Dr. Linden, »ist ihre Endgültigkeit. Jetzt können Sie es sich noch anders überlegen, hinterher nicht mehr - wenn das Baby tot ist.«
»Ich werde es mir nicht anders überlegen.« Er nickte und paffte weiter vor sich hin. »Das is t gut.« Der süße Geruch des Tabaks ließ Jennifer müde werden. Sie wünschte, er würde die Pfeife weglegen. »Dr. Linden...« Er stand widerstrebend auf und sagte: »Na gut, junge Frau, dann wollen wir Sie einmal anschauen.« Jennifer legte sich im Untersuchungsstuhl zurück, die Füße auf den kalten Metallsteigbügeln. Sie fühlte seine Finger in ihrem Körper herumtasten. Sie waren sanft und erfahren, und Jennifer fühlte keine Verlegenheit, nur ein unbeschreibliches Gefühl der Verlorenheit, einen tiefen Kummer. Unerwünschte Visionen tauchten vor ihren Augen auf, Bilder von ihrem Sohn, denn sie war sicher, es wäre ein Sohn geworden, wie er spielte, im Garten herumlief und lachte, wie er aufwuchs, ein Abbild seines Vaters.
Dr. Linden hatte seine Untersuchung beendet. »Sie können sich jetzt anziehen, Mrs. Parker. Wenn Sie wollen, können Sie die Nacht über hierbleiben, und morgen früh werden wir dann die Operation durchführen.«
»Nein!« Jennifers Stimme klang schärfer als beabsichtigt. »Ich möchte es sofort gemacht haben.«
Dr. Linden studierte sie noch einmal, einen verwirrten Ausdruck auf dem Gesicht.
»Ich habe noch zwei Patientinnen vor Ihnen. Ich schicke die Schwester zu Ihnen, damit sie ein paar Laboruntersuchungen durchführt, und lasse Sie dann in Ihr Zimmer bringen. In etwa vier Stunden nehmen wir dann den Eingriff vor. Einverstanden?« Jennifer flüsterte: »Einverstanden.«
Sie lag auf dem schmalen Krankenhausbett, die Augen geschlossen, und wartete auf Dr. Lindens Rückkehr. An der Wand hing eine altmodische Uhr, und ihr Ticken erfüllte den ganzen Raum. Aus dem Tick-Tack wurden Worte: Adams Sohn, Adams Sohn, Adams Sohn, unser Kind, unser Kind, unser Kind.
Jennifer konnte sich einfach nicht gegen das Bild des Babys wehren, das in diesem Augenblick in ihrem Leib war, das es gemütlich und warm hatte, das, geschützt gegen die Welt, in der Fruchthülle in ihrem Schoß lebte. Sie fragte sich, ob es irgendeine instinktive, urzeitliche Furcht vor dem empfand, was mit ihm geschehen würde. Sie fragte sich, ob es Schmerz empfinden würde, wenn das Messer es tötete. Sie preßte die Hände gegen die Ohren, um das Ticken der Uhr abzuschalten. Sie stellte fest, daß sie begonnen hatte, heftig zu atmen, und daß ihr Körper schweißbedeckt war. Sie hörte ein Geräusch und öffnete die Augen.
Dr. Linden stand über sie gebeugt, einen besorgten Ausdruck auf dem Gesicht. »Geht es Ihnen gut, Mrs. Parker?«
Читать дальше