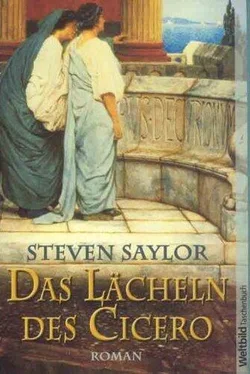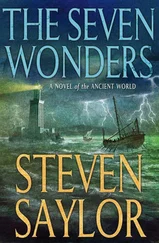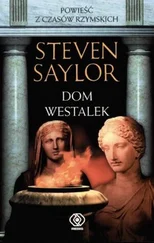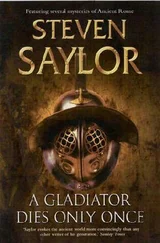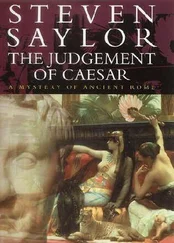Bundesgenossenkrieg Luft gemacht hatten. Im Süden und Osten hatte ich die
Verwüstungen von zehn Jahren Krieg mit eigenen Augen gesehen - zerstörte Bauernhöfe, Brücken und Straßen, Leichenberge, die unbedeckt vor sich hinfaulten, bis sie zu Knochenbergen geworden waren.
Im Norden hatte ich das gleiche Bild erwartet, aber das Land war größtenteils unversehrt; hier waren die Menschen vorsichtig bis zur Feigheit gewesen, hatten mit ihren Einsätzen bis zum letzten Moment gezögert und waren so lange auf dem goldenen Mittelweg geblieben, bis sich ein klarer Sieger abgezeichnet hatte, auf dessen Seite sie sich dann eilends geschlagen hatten. Im Bundesgenossenkrieg hatten sie sich geweigert, sich den
aufständischen Stämmen anzuschließen, die gegenüber Rom auf ihre Rechte pochten, sondern hatten statt dessen gewartet, bis Rom sie um Hilfe bat, und sich so die gleichen Rechte ohne Revolte gesichert. In den Bürgerkriegen hatten sie auf des Messers Schneide zwischen Marius und Sulla, zwischen Sulla und Cinna getanzt, bis der Diktator als Triumphator daraus hervorgegangen war. Sextus Roscius der Ältere hatte sich allerdings schon offen zu Sulla bekannt, bevor es opportun wurde.
Der Krieg hatte die sanft geschwungenen Weiden und dichten Wälder, die die südlichen Gefilde von Etrurien und Umbrien bedeckten, intakt gelassen. Während man in anderen Regionen die Erschütterungen, die Krieg und Umsiedlungen mit sich gebracht hatten, auf tausenderlei Weise spüren konnte, herrschte hier ein Gefühl von Zeitlosigkeit und Unveränderlichkeit, ja beinahe Stagnation vor. Die Menschen begegneten einem Fremden weder mit Freundlichkeit noch mit Neugier; von den Feldern drehten sich Gesichter nach mir um, starrten mich leeren Blickes an und wandten sich dann mit mißmutiger Miene wieder ihrer Arbeit zu. Magere Rinnsale tröpfelte durch steinige Flußbetten; ein feiner Staub bedeckte und verhüllte alles. Die Hitze lastete schwer auf dem Land, aber noch etwas anderes schien wie eine Decke über der Erde zu liegen: eine erstickende und entmutigende Schwermut unter dem gleißenden Sonnenlicht.
Die Monotonie der Reise ließ mir Zeit zum Nachdenken; die sich ständig verändernde Landschaft befreite den Verstand aus den spinnenwebartigen Straßen und Sackgassen Roms. Doch das Rätsel, wer den Angriff auf mein Haus befohlen hatte, entzog sich weiter einer Lösung. Nachdem ich meine Ermittlung ernsthaft aufgenommen hatte, drohte mir von allen Seiten und aus jedem Lager Gefahr - der Ladenbesitzer und seine Frau, die Witwe, die Hure, jeder hätte den Feind warnen können. Aber meine Besucher waren bereits am frühen Morgen gekommen, einen Tag, nachdem ich mich mit Cicero getroffen hatte und für den Fall engagiert worden war, als ich selbst erst auf dem Weg zum Tatort war und noch keine Befragung durchgeführt hatte. Ich listete die Namen derjenigen auf, die schon am Tag zuvor von meinem Engagement gewußt hatten: Cicero selbst und Tiro, Caecilia Metella, Rufus Messalla, Bethesda. Wenn die Intrige gegen Sextus Roscius nicht auf verrückte Weise unlogisch und noch verwickelter war, als ich ahnte, hatte keiner dieser Menschen einen Grund, mich von dem Fall abzuschrecken. Es gab natürlich immer die Möglichkeit eines lauschenden Sklaven entweder in Ciceros oder Caecilias Haus; ein Spion, der die Information an die Feinde von Sextus Roscius weitergeleitet hatte, aber in Anbetracht der von Cicero inspirierten Loyalität und der Art von Bestrafungen unter Caecilias Regime schien mir die Wahrscheinlichkeit lächerlich gering. Trotzdem hatte irgend jemand früh genug von meiner Verwicklung in den Fall erfahren, um dafür zu sorgen, daß tags darauf angemietete Schläger vor meiner Tür standen, irgend jemand, der auch bereit war, mich umbringen zu lassen, wenn ich die Sache nicht fallenließ.
Je länger ich darüber nachdachte, desto verworrener wurde das Problem, und die Gefahr schien ständig zu wachsen, bis ich mich zu fragen begann, ob Bethesda an dem Ort, an dem ich sie zurückgelassen hatte, wirklich sicher war. Wie konnte ich sie schützen, wenn ich keine Ahnung hatte, aus welcher Richtung sie bedroht wurde? Ich schob die Zweifel beiseite und starrte auf die vor mir liegende Straße. Furcht war fruchtlos. Nur die Wahrheit konnte mir Sicherheit bringen.
Bei der zweiten Tiberüberquerung machte ich für einen Moment im Schatten einer riesigen Eiche am Ufer halt. Während ich noch rastete, kamen von Norden ein grauhaariger Bauer und drei Aufseher geritten mit einem Zug von dreißig Sklaven im Schlepptau. Der Bauer und zwei seiner Männer stiegen ab, während der dritte die Hals an Hals geketteten Sklaven zum Trinken an den Fluß führte. Der Bauer und seine Männer hielten sich abseits. Nach ein paar mißtrauischen Blicken in meine Richtung ignorierten sie mich vollends. Aus den wenigen Fetzen ihres Gespräches, die zu mir herüberdrangen, schloß ich, daß der Bauer aus Narnia stammte und unlängst in der Nähe von Falerii zu Land gekommen war, wohin die Sklaven jetzt geführt wurden, um die dort eingesetzten Arbeiter zu verstärken.
Ich nahm einen Bissen Brot und einen Schluck aus meinem Weinschlauch, wobei ich träge eine Biene verscheuchte, die meinen Kopf umkreiste. Die Sklaven stellten sich nebeneinander am Ufer auf, fielen auf die Knie, spritzten sich Wasser ins Gesicht und beugten sich nieder, um wie die Tiere zu trinken. Die meisten von ihnen waren mittleren Alters, einige wenige älter, ein paar jünger. Zum Schutz ihrer Füße trugen sie alle eine Art Sandalen, einen Fetzen Leder, den man ihnen unter die Füße gebunden hatte. Ansonsten waren sie nackt mit Ausnahme von zwei oder drei Sklaven, die sich einen dünnen Lumpen um die Hüfte gewickelt hatten. Viele hatten frische Narben und Striemen auf ihrem Hintern und ihrem Rücken. Selbst die kräftigsten von ihnen sahen ausgezehrt und ungesund aus. Der Jüngste oder doch zumindest Kleinste von ihnen war ein magerer, nackter Junge am Ende des Zuges. Er schluchzte in einem fort und murmelte die ganze Zeit etwas von seiner Hand, die er in einem unmöglichen Winkel in die Luft hielt. Der Aufseher brüllte ihn an, stampfte mit dem Fuß auf und ließ seine Peitsche knallen, aber der Junge hörte nicht auf zu klagen.
Ich aß mein Brot auf, trank einen Schluck Wein und lehnte mich gegen den Baum. Ich versuchte, mich auszuruhen, aber das unaufhörliche, nur vom Knallen der Peitsche unterbrochene Gejammer zerrte an meinen Nerven. Für einen reichen Bauern sind Sklaven billiger als Vieh. Wenn sie sterben, sind sie mühelos zu ersetzen; der Zufluß von Sklaven nach Rom nimmt kein Ende, wie Wellen, die sich am Strand brechen. Ich bestieg Vespa und ritt weiter.
Der Tag wurde immer heißer. Den ganzen Nachmittag lang sah ich kaum einen Menschen. Die Felder waren verlassen worden, bis die Luft sich wieder ein wenig abkühlte, die Straßen waren leer; ich hätte genausogut der einzige Reisende auf der ganzen Welt sein können. Als ich die Gegend von Narnia erreichte, begann sich das Leben auf den Feldern wieder zu regen, und der Verkehr wurde langsam dichter. Narnia selbst ist eine geschäftige Marktstadt. Die Einfallstraßen werden von Grabsteinen und Tempeln gesäumt. Im Zentrum stieß ich auf einen breiten Platz, der im Schatten einiger Bäume lag und von kleinen Läden und Ställen umgeben war. Der süße Duft von Stroh und die strengen Gerüche von Ochsen, Kühen und Schafen lagen schwer in der erhitzten Luft.
An einer Ecke des Platzes befand sich eine kleine Taverne. In die offene Holztür war eine Lehmfliese eingelassen, die einen jungen Hirten zeigte, der sich ein Lamm über die Schulter geworfen hatte; ein Holzschild unter dem Sturz hieß den Gast in der Taverne Zum blökenden Lamm willkommen. Das Innere des Lokals machte einen düsteren und finsteren Eindruck, aber es war kühl. Der einzige andere Gast war ein abgemagerter alter Mann, der an einem Tisch in der Ecke saß und ausdruckslos ins Leere starrte. Der Wirt war ein unglaublich fetter Etrusker mit dunkelgelben Zähnen; er war so riesig, daß er den winzigen Raum fast alleine füllte. Er war glücklich, mir einen Becher des hiesigen Weins bringen zu dürfen.
Читать дальше