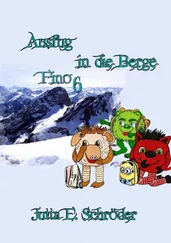»Ich möchte zu Herrn Thon«, sagte ich der netten Dame am Empfang.
»Ich sage ihm Bescheid. Moment bitte.«
Ich musste nicht lang warten, bis ein eher jugendlich wirkender Mann mit wehendem Kittel durch die Schwingtür trat. Er streckte mir die Hand entgegen. Ich zögerte.
»Schon okay, viele Leute geben mir ungern die Hand«, sagte er grinsend.
Ich spürte, dass ich rot wurde. »Ich möchte Sie nicht anstecken«, entgegnete ich und sprach dabei absichtlich durch die Nase.
»Meinen Patienten wäre das egal.« Wieder dieses jungenhafte Grinsen. »Kommen Sie mit.«
Er führte mich eine Treppe hinunter in einen Gang, der von flackernden Neonröhren erhellt wurde. Weiter hinten ging eine Tür auf und eine Bahre mit einer von einem weißen Tuch verdeckten Gestalt darauf wurde von einer Frau in den Flur geschoben. Ich blieb stehen, als sei ich gegen eine Wand gelaufen.
»Ist Ihnen nicht gut?«, fragte Thon mit besorgtem Gesichtsausdruck. »Wir gehen gleich in mein Büro, ich muss hier nur noch schnell etwas abgeben.«
Er musterte mich mit Sorgenfalten auf der Stirn. »Okay, Planänderung. Sie sind ganz bleich, da nehmen wir lieber gleich den Aufzug.« Herr Thon, vermutlich Herr Doktor Thon, aber das hatte er weder am Telefon noch gerade eben gesagt, nahm mich am Arm und schob mich zum nächstgelegenen Aufzug.
Ein Lastenaufzug. Groß genug, um Bahren oder Särge oder sonstige Behältnisse mit Leichen drauf oder drin zu transportieren. Ich fühlte, wie mir das Blut in den Magen sackte.
»Es dauert nur dreißig Sekunden bis in mein Büro. Da bekommen Sie ein Glas Wasser und eine schöne Aussicht auf den blauen Himmel.«
Lügner, dachte ich, während sich auf meiner Stirn die Schweißtröpfchen sammelten. Der Himmel ist grau und düster und bedrohlich und sieht nach noch mehr Schnee aus.
»Entschuldigen Sie bitte. Ich bin manchmal etwas gedankenlos. Mir macht die Umgebung nichts mehr aus, daher vergesse ich immer wieder, dass andere Menschen sich hier unwohl fühlen.«
Ich saß oder besser gesagt hing auf seinem Besucherstuhl und hatte das Glas abgestellt, damit es nicht aus meinen zitternden Händen fiel. Alle möglichen Gedanken schossen mir durch den Kopf, einer absurder als der andere. Was wäre, wenn ich Herrn Dr. Thon mein Kofferraumproblem einfach vor die Tür kippen würde? Wäre dann gleich die Polizei mit im Spiel? Ich könnte ihn aber auch gleich mal fragen, wo man einen Toten denn am besten loswird. Er hätte bestimmt eine Idee. Mit einem Stein um den Fuß im See versenken oder in eine Baugrube werfen, die am nächsten Tag betoniert würde, oder ab in den Rhein damit, dann könnten die Holländer sich mit dem Problem befassen.
Doch statt zu fragen lächelte ich. Thon lächelte zurück.
»Sollen wir lieber über meine unaufgeräumte Wohnung reden?«
Ich nickte. Er sprach über seine Abneigung gegen das Aufräumen, das Putzen, das Waschen und das Bügeln und erzählte, dass er sich in seiner Wohnung eigentlich ganz wohl fühle. Allerdings gäbe es da diese Frau in seinem Leben. Der Herr Doktor wurde rot. Sie fände seine Junggesellenbude grässlich und lehne es ab, ihn dort zu besuchen, geschweige denn, zu übernachten. Das müsse sich ändern, daher brauche er Hilfe. Ich erläuterte unser Dienstleistungsangebot und nannte die Preisspannen und er war sehr angetan von allem und erteilte mir mit Freuden den ersten Auftrag. Wir verabredeten einen Termin für die Wohnungsbesichtigung und er sah erleichtert aus. Wieder konnte ich einem Menschen bei der Lösung seiner Probleme helfen. Und wann half mir bitte schön mal jemand, mein Problem zu beseitigen?
Soweit mein Katastrophenbericht der vergangenen Tage. Es ist Freitag, der Tote liegt nun seit drei Tagen in meinem Kofferraum. Meine Nerven werden das Wochenende nicht überleben, wenn er nicht endlich verschwindet. Heute Abend muss es über die Bühne gehen! Die Voraussetzungen hierfür sind allerdings verheerend: Meine Erkältung hat sich zurückgemeldet, ich habe hohes Fieber und befürchte, die nächsten Tage nicht ganz zurechnungsfähig zu sein.
Dennoch fahre ich bei einsetzender Dämmerung los. Ich ignoriere, dass ich nach wie vor keinen genauen Plan habe. Den Rhein habe ich ausgeschlossen, weil ich Angst habe, dass er die Leiche an der nächsten Buhne wieder an Land wirft. Eine Baugrube ist ungünstig, denn im Winter wird sowieso wenig betoniert und schon gar nicht am Samstag. Der See gefällt mir aus rein praktischen Gründen nicht. Erstens kenne ich nur den Unterbacher See, und an dem herrscht ständig Verkehr von Joggern mit Stirnlampen und Hundehaltern mit ihren Viechern. Zweitens wüsste ich nicht, wo ich dort ein Boot herkriegen sollte, geschweige denn unauffällig eine Leiche hineinbugsieren. Drittens habe ich keinen schweren Stein und viertens keine Kette, mit der ich ihn dem Toten an die Beine hängen kann. Selbst wenn all das funktionieren würde, würde ich vermutlich bei dem Versuch, die Leiche zu versenken, selbst über Bord gehen. Das Wasser ist einfach nicht mein Element.
Vielleicht macht es mehr Sinn, an den Ort zurückzukehren, an dem ich den Toten gefunden habe. Er hat sich in den letzten Stunden seines Lebens in Oberrath aufgehalten, vielleicht war das ein Ortsteil, den er häufiger aufsuchte. Wenn seine Leiche dort in der Gegend gefunden würde, wäre das weniger verdächtig. Das erscheint mir plötzlich logisch und klar. Warum bin ich nicht viel früher draufgekommen?
Wie in Trance lenke ich mein Auto Richtung Oberrath und biege vor der Autobahnauffahrt nach rechts in den Wald ab. Ein Gebiet, das im Sommer und an Wochenenden mit schönem Wetter von Spaziergängern, Joggern und Reitern bevölkert wird, an diesem kalten Abend mit leichtem Schneefall aber verlassen daliegt. Langsam fahre ich die Straße entlang, biege ab Richtung Segelflughafen, aber jedes Mal, wenn ich denke, dass ich jetzt wirklich weit und breit die einzige lebende Seele bin, taucht wieder ein Auto, ein Jogger mit Stirnlampe oder ein Hundebesitzer auf. Resigniert verlasse ich den Wald und fahre wieder Richtung Innenstadt. Ich bin verzweifelt, kann kaum noch aus den tränenden Augen schauen und spüre, wie das Fieber steigt. Inzwischen denke ich ernsthaft darüber nach, den Wagen irgendwo abzustellen, mit Benzin zu übergießen und anzuzünden. Aber wahrscheinlich kann die Polizei auch danach noch feststellen, dass der Wagen nicht leer gewesen war. Das sieht man doch immer wieder in allen ›Tatorts‹ und ›Sokos‹.
Ich fahre langsam im dichter werdenden Schneetreiben mit Tausenden anderen Autos in Richtung Innenstadt, als mich ein Niesanfall packt. Zweimal, dreimal, viermal, alles läuft, ich kann nichts mehr sehen und biege daher vor der Auffahrt zur Brücke nach rechts auf einen großen, leeren Platz ein. Es dauert mehrere Minuten, bis ich mich so weit beruhigt habe, dass ich wieder aus den Augen gucken und meine Umgebung bewusst wahrnehmen kann.
Ich befinde mich auf dem alten Bahngelände. Hier halten Güterzüge, werden Waggons ab- und angekoppelt und zu neuen Zügen zusammengestellt. Das weiß ich, weil Greg und ich damals eine Wohnung ganz in der Nähe besichtigt haben. Der Lärm der Güterzüge hat uns schließlich davon abgehalten, sie zu mieten.
Greg! Meine Augen füllen sich erneut mit Tränen, als ich an ihn denke. Wie sehr könnte ich jetzt seine starken Arme brauchen.
»Sentimentalität ist etwas für samstagabends, mein Kind«, hatte Oma früher gesagt, wenn ich sie fragte, ob ich wohl einmal einen Märchenprinzen heiraten würde. »Märchenprinzen taugen fürs Kino, aber nicht fürs Leben. Denke praktisch, nur so kommst du weiter.«
Omas Stimme im Kopf lässt meine Träume versiegen. Mit verquollenen Augen starre ich in die Dunkelheit und sehe auf einmal die Lösung meines Problems klar und hell vor mir: Ich müsste nur die Leiche in einen der vielen Waggons packen, die darauf warten, zu einem Zug zusammengestellt und irgendwohin weit weggebracht zu werden, dann wäre ich den Kerl los. Genau das ist es! Ich unterdrücke gerade noch einen Jubelschrei und steige aus dem Auto.
Читать дальше