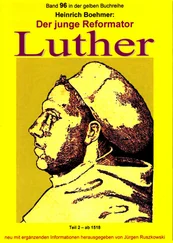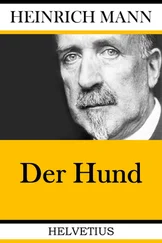Wir kauften noch Regenjacken für alle Fälle sowie zwei Wanderstöcke für mich und Kerstin. Simon aber wünschte sich eine Skibrille. Ich versuchte ihm zu erklären, daß eine luftige Sonnenbrille in dieser Jahreszeit passender wäre, und zeigte auf ein Regal mit dementsprechenden Produkten. Doch der Junge blieb stur, beließ seine Hand auf dem breiten schwarzen Rahmen mit der khakifarbenen Scheibe. Allerdings war ich entschlossen, nicht jedem seiner Wünsche nachzukommen, bloß weil er ein» besonderer «Mensch war. Ich erklärte ihm, daß wir nicht vorhätten, in den Himalaja zu reisen, zeigte auf die Skibrille und sagte:»Nein!«Ich forderte ihn auf, hinüber zu den schicken Kinderbrillen zu wechseln und sich dort eine auszusuchen.
Er aber blieb stehen. Ich sah die Träne, die aus seinem Augenwinkel trat, eine Spur ziehend, wie ein winzig kleiner Skifahrer, der den steilen Abhang ein kurzes Stück abwärts fährt und abrupt bremst.
«Ich hasse Tränen«, sagte ich laut.»Tränen sind unfair.«
Ich redete mehr zu mir selbst. Doch Kerstin kam herüber und meinte:»Meine Güte, kauf ihm doch die Skibrille. Oder soll ich?«
«Es geht doch nicht ums Geld. Er soll einfach nicht alles kriegen, was er will. Und dann auch noch die Heulerei als Druckmittel einsetzen.«
«Er heult nicht«, sagte Kerstin.»Er weint. Und zwar ziemlich zurückhaltend, finde ich.«
Ich haßte nicht nur Tränen, sondern auch die Toleranz jener, die im speziellen Fall keine Verantwortung trugen. Die mit den Kindern nie zum Zahnarzt mußten, aber ständig meinten, es würde doch auf das eine oder andere Bonbon nicht ankommen. Nun, es kommt auf den einen oder anderen Müllberg auch nicht an, aber die Müllberge zusammen sind dann doch ein Problem. Genau das sagte ich zu Kerstin.
«Na, ein Bonbon kann man vielleicht mit einem Müllberg vergleichen«, gab sie zurück.»Aber eine Skibrille ist doch etwas anderes. In erster Linie nützlich. Und vielleicht hat Simon einen guten Grund, sich genau die zu wünschen.«
«Jetzt im Sommer?«
«Jetzt im Sommer. Möglicherweise weiß er was, was wir nicht wissen.«
Ich gab auf. Ich sagte:»Okay.«
Sofort kehrte ein Lächeln in Simons Gesicht ein. Die Träne war nur noch ein Schimmer von blassem Silber.
Was ich folgendermaßen kommentierte:»Also, das Wort okay versteht er ganz gut, mein kleiner Sohn.«
«Komm, das hätte jetzt sogar ein Marsianer verstanden«, fand Kerstin.»Wie du zuerst seufzt und leidest und dich windest und dann halt mit der Schulter zuckst und nachgibst.«
«Was willst du mir eigentlich sagen, Kerstin?«fragte ich.
«Weiß nicht … vielleicht, wie sehr ich es mag, wenn du kapitulierst. Wenn du weich wirst.«
Ich schnaufte und grinste und vollzog eine ironische Körperbewegung, die das Wort» weich «illustrierte.
Einen Tag vor der geplanten Fahrt nach Tirol ging ich mittags mit Simon zum Italiener. Er liebte Spaghetti, nicht allein den Geschmack, sondern auch das Ritual des abenteuerlichen Verzehrs: der Länge der Nudeln Herr zu werden.
Wir waren ohne Kerstin, die sich mit einer Freundin traf oder mit einem Freund, mit jemandem aus Schultagen, der jetzt in Stuttgart lebte, wie sie mir sagte. Aber nicht, um wen es sich handelte und ob die Beziehung zu dieser Person über das gemeinsame Lernen und gemeinsame Schummeln hinausgegangen war. Ein kleiner Stich von Eifersucht plagte mich. Wieso auch diese Heimlichtuerei?
Wir nahmen an dem Ecktisch des kleinen Restaurants Platz und wurden vom Patron persönlich begrüßt. Ich kannte das Lokal seit den Tagen, als ich nach Stuttgart gekommen war. Es lag unweit meiner Wohnung. Man konnte sich hier ganz tief ins Italienische eingegraben fühlen: diese so ungemein nonchalant inszenierte Aufgeregtheit, die Art, wie anstatt einer Speisekarte die Gerichte des Tages mündlich vorgetragen wurden (ich verstand auch nach Jahren kaum, wovon die Rede war und war in diesem Nichtverstehen ganz eins mit Simon) und ich dann stets zwei Portionen Spaghetti aglio e olio bestellte. Doch niemals wäre der Wirt auf die Idee gekommen, die wortreiche Beschreibung der Gerichte auszulassen, zudem hörten wir jedes Mal mit Begeisterung zu, so, als würden wir einer sehr kurzen Oper lauschen.
Als ich mit Simon für einige Tage in Italien gewesen war, hatte ich mit Schrecken festgestellt, wie wenig das tatsächliche Italien an das Italien dieses Stuttgarter Restaurants herankam. Dort waren wir blöde Touristen, die man ohne Scham und Stil beschiß, hier aber willkommene Freunde. Die meisten der anderen Gäste waren Italiener, die alle — nicht nur die Alten — einen Hauch von Marcello Mastroianni verströmten: eine Ungeschicklichkeit, die sich in eine bezaubernde Revuenummer verwandelt hatte. Ein Stolpern als perfekte Form. Die Italiener in Italien wirkten dagegen wie Fälschungen, wie ein großangelegter europäischer Betrug. Eine Klischeemaschine statt einer Kaffeemaschine. So gesehen, war Berlusconi wirklich der richtige Mann. Der Richtige im Falschen.
Übrigens saßen Simon und ich stets nebeneinander, nie einander gegenüber. Wie ein altes Ehepaar hockten wir da, beobachteten die Hereinkommenden oder sahen hinüber zum Stammtisch, wo vor allem Männer in Overalls und zwei, drei Anzugträger mit spitzen Schuhen zusammentrafen. Mitunter nahm Simon einen Zeichenblock heraus und verfertigte Graphiken, die durchaus an seine eigene Sprache erinnerten: abstrakte Formen und Muster, die jedoch den Verdacht nahelegten, gar nicht wirklich abstrakt zu sein, sondern nur für den, der ihren Ursprung nicht kapierte. Was freilich für jede Abstraktion irgendwie gilt.
Kamen die Spaghetti, legte Simon die Stifte zur Seite, griff nach der Gabel und begann nun, eine einzelne Nudel aus dem öligen Nudelberg zu ziehen, sie hoch in die Luft zu heben, eines der Enden zwischen die Lippen zu fügen und sie sich sodann laut saugend und in einem einzigen langen Zug einzuverleiben. Man konnte meinen, er ziehe die Teigschnüre im Mund zu Spiralen zusammen, zu Unruhen . In der Folge kaute Simon ein wenig, schluckte, dann angelte er sich die nächste. Nach einigen auf diese Weise verspeisten Spaghetti besaß sein Mund einen öligen Glanz, nicht nur die Lippen, sondern auch Kinn, Wangen und die kleine Nische, die zur Nase hochführte. Sein Gesicht sah dann aus wie ein halb gefirnißtes Gemälde. Ab und zu unterbrach er das Essen, um über den Teller zu langen und an seiner Zeichnung weiterzuarbeiten. Was ich eigentlich hätte verbieten müssen, wie man beim Essen das Fernsehen verbietet, andererseits heißt es ja immer, man solle während der Nahrungsaufnahme Pausen einlegen, um der Verdauung Zeit zu geben. — Man kann nicht alles haben. Weshalb ich ihn gewähren ließ.
Jedenfalls liebte ich diese Momente des Zusammenseins. Und genehmigte mir auch gerne ein Glas Wein, einen Mittagswein, was natürlich die Einstiegsdroge zum Alkoholismus war, bevor schließlich der Vormittagswein oder gar der Frühstückswein oder Vorfrühstückswein einen wahrhaftigen Trinker aus einem machte. Was keineswegs mein Plan war. Vor allem wegen der Figur. Immerhin besaß auch der Alkohol seine Schokoladenseite.
Allerdings empfand ich den Zustand, den der Mittagswein nach sich zog, als höchst angenehm: als hätte die Schwerkraft leicht abgenommen — nicht so stark wie auf dem Mond, man brauchte sich also nicht als dick eingepackter Astronaut zu fühlen. Aber da war eine Verzögerung, eine feine Leichtigkeit, eine Welt, die weniger wog. Und der es guttat, daß sie weniger wog.
Mitunter nahm ich einen solchen Mittagswein auch zu mir, wenn ich meine bademeisterliche Tätigkeit ausübte, was natürlich verboten war. Wäre jemand ertrunken und man hätte gleichzeitig festgestellt, daß ich … Na ja, ich tat so was auch nur im Winter und Herbst, wenn die Alten im Wasser waren, die alle exzellente Schwimmer waren und auf dem Wasser ein sehr übersichtliches Badehaubenmuster bildeten. Kaum Risiko. Es war nur wichtig, daß niemand es roch, wenn ich trank, weshalb ich mir als Konsequenz solch milder Sedierung immer einen Schuß Mundspray verabreichte.
Читать дальше