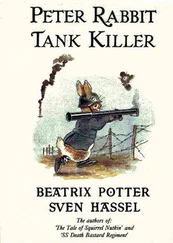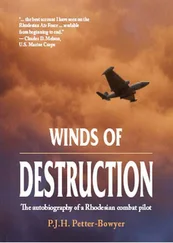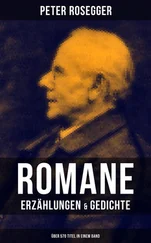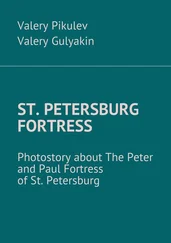VOR DIESER REISE liegen andere Reisen. Ich bin sechsunddreißig Jahre. Ich fahre nach Nienhagen, das Heim ansehen, um das Haus herumgehen, das drei Jahre lang meine Heimstatt war. Wie bekannt mir nach dreißig Jahren das Haus vorkommt und zum Heim das Tor, die Gartenpforte, die da ein Dasein gefristet hat zwischen zwei krummen Pfeilern, leicht schief gen Himmel gerichtet, in trostlos rostigen Verankerungen. Rechts und links faustdicke Lücken, durch die Katze und Hund mühelos hindurchschlüpfen. Die Hecken weiß ich leicht mit Schneepulver bestäubt, oder es handelte sich um eine Weißdornhecke.
Es gibt keine Stunde Null. Kein Tag lässt sich bestimmen. Es ist keine Zeit für Chronologie. Ich lüge, wenn ich die Reise zu Mutter als wichtigste Reise meines Lebens nenne. Ich spreche wahr, wenn ich die Reise nach fünfzig Jahren Trennung als gewagt und niederschmetternd für mich bezeichne, weil ich mir vom Besuch bei der Mutter keinerlei Linderung erwarten darf. Ich hätte fliehen können, nachdem ich das halbe Jahr ausgebildet worden bin, Fluchten zu verhindern, an der Grenze Wache zu schieben, im Frühtau vallera, grün schimmern wie Smaragde alle Höhen, vallera, wir wandern ohne Sorgen singend in den Morgen noch ehe im Tale die Hähne krähen, ihr alten und hochweisen Leut, vallera, ihr denkt wohl wir wären nicht gescheit, vallera, in dieser herrlichen Frühlingszeit, wir sind hinausgegangen, den Sonnenschein zu fangen, kommt mit und versucht es doch auch einmal. Auf der Rundreise von Heim zu Heim und zu den Stätten meiner Frühgeschichte wandle ich über den fußschmalen Weg am Sportplatz vorbei zum Waldstreifen hin, durch das Wäldchen genannte Teilstück zur Steilküste, um an meiner Stelle wieder am Geländer die breiten Stufen der Treppe zum Strand hinabzugehen, von dort bis an meine Lieblingsstelle, meinen Aussichtsturm, meinen früheren Ausruhpfosten, um die Einsamkeit von damals auszuleben, in die es mich immer wieder gelockt hat. Jahre später sitze ich also wieder mit dem Rücken gegen den Pfosten gelehnt, suche mit dem Herzen herauszufinden, was ich wohl gefühlt haben mag. Der Wind ist lange Zeit meine Mutter. Der Wind wischt mir die Tränen fort. Der Regen ist eine Zeit lang meine Mutter. Regen nässt mein Haar. Die Wellen der Ostsee sind meine Mutter. Die Wellen wiegen meine Gedanken. Ich halte mich an meinen Schwimmreifen geklammert über Wasser. Die Sonne ist meine Mutter. Der kalte Mond am Himmel ist meine Mutter. Zur Nacht ist die rabenschwarze Nacht lang meine Mutter.
ICH BIN AN DER OSTSEEKÜSTE, mache lange Spaziergänge, denke nach, und ich erinnere mich nach Jahren der Abkehr im Grunde an keine Herkunft, wie ich zwar die Namen der Orte zu benennen weiß, aber nirgends zu Hause bin, keine Heimat habe, mich den Leuten nicht zugehörig fühle, den Menschen gegenüber fern bleibe, mich von den Leuten nie entfernen konnte, weil sie mir nicht nahe waren, sie mich der Bestimmung überlassen haben.
Ich stehe auf dem Hügel. Ich sehe über Landschaft. Alles was vor mir ausliegt, ist gut einsehbar. Nichts ist abstoßend zu nennen. Ich bin zurück. Ich verweile an den Orten, die früher zu mir und meinem Leben gehörten. Niemand außer mir weiß davon, weiß, was ich fühle, wie ich empfinde, wenn ich vor einem Haus stehe, in eine Straße gehe, an einem Zaun stehen bleibe und etwas mit der Hand berühre, was es für mich zu schätzen gibt, in der mir fremd gebliebenen Heimstatt. Ich gehe Wege und fühle mich der Region wieder verbunden. Die Heimleiterin könnte gestorben sein. Die Köchin liegt längst begraben wie auch meine Adoptionseltern.
ES REGNET. Es gibt Schwierigkeiten mit den Scheibenwischern. Ich halte an, verlasse das Gefährt, fummle an den Scheibenwischern, lasse sie zwei-, dreimal gegen die Scheibe klatschen, sitze wieder hinterm Lenkrad und freue mich, dass sie wieder funktionieren. Die Adoptionseltern sind gestorben. Ich bin mir meiner Einsamkeit auf Erden bewusst. Ich bin so allein wie nie in meinem Leben und zu der Frau unterwegs, die nie meine Mutter war, aber doch meine leibliche Mutter ist, mich geboren, mich verworfen hat, alles begonnen, alles ausgetragen, alles beendet, mich ausgelöscht und nie mehr ausgelöst hat, mich in diese Einsamkeit hineingestoßen hat, dieses tiefe Loch, das meine lebenslange Grube ist. Ich bin auf dem Rastplatz nahe der Autobahn. Ich trockne irgendwo die Hände an dem Papier aus dem Papierspender neben dem Waschbecken, ziehe mit dem feuchten Finger die Augenbrauen nach. Ich gehe zur Toilette hinaus. Ich sitze im Wagen. Ich weiß wieder, dass es mir eine Zeit lang unmöglich gewesen ist, schwimmen zu gehen. Ich sah die Haut mit Muttermalen übersät. Zeichen leuchteten auf. Zeichen brennen heute wieder, wenn ich die Erinnerung belebe. Muttermale blühen auf und nehmen rapide an Zahl zu, wenn die Haut mit Wasser in Berührung kommt. Fruchtwasser. Brandblasen. Fruchtblase. Löschwasser, denke ich, sehe mich im Heim in der Badewanne. Zum Glück bin ich allein. Zum Glück bekommt niemand etwas mit. Zum Glück sieht außer mir niemand die Muttermale blühen und zahlreicher werden. Sie erscheinen und breiten sich aus. Sie rücken auf meiner Haut dichter zusammen, bilden Gruppen, rudeln, flirren bis meine Haut ein Himmel ist aus Muttermalen. Wie Sterne leuchten, sehe ich mich in eine von geheimer Wasserzeichenschrift beschriebene, mir zunehmend fremder werdende Haut gepfropft.
Ich stecke in einer Haut, die mich von innen her beschriftet. Mit Botschaften überzogen sehe ich mich, die einzig von der Mutter stammen können. Die Mutter schreibt an mich. Sie schreibt aus mir hervor. Ich fürchte die Schrift, weil ich die Mutter in ihr nicht erkenne, von der Mutter auch nichts weiß; die mir unter die Haut gefahren ist und nun versucht, als Schrift durch die Haut zu mir aufzubrechen. Ich sitze steif am Rand des Strandes. Den Kopf gesenkt, als suchte ich etwas im Sand vor mir. Man lässt mich sein, wie ich momentan bin. Von der Gruppe entfernt, wünsche ich in dem Moment, mir könnte die alte Haut abgestreift und eine neue Haut über den Leib gestülpt werden. Eine frische, frohe Haut. Eine Hülle ohne die quälenden Male. Notfalls hautfrei leben, von Muttermalen verschont. Und plötzlich sehe ich mich als wasserscheuen Menschen, der den Leuten allzu oft rätselhaft ist. An der Ostsee groß geworden, drängt es mich an heißen Tagen nicht zu schwimmen, den Körper im Wasser abzukühlen. Die Liebste hat längst aufgegeben, mit mir in einer Badewanne zusammen sein zu wollen. Ich gehe nicht an Strände. Ich gehe nicht in Hallenbäder. Ich meide Demonstrationen, bei denen man mich mit Wasser bewirft. Ich meide Regen. Ich steige mit anderen Menschen in kein Wasser hinein. Ich dusche nur daheim, wenn ich mich allein weiß. Ich meide jeden Wasserstrahl. Ich schließe mich ins Badezimmer ein. Ich gehe angekleidet hinein und komme vollständig angekleidet wieder heraus. Es ist mein Geheimnis. Es geht niemanden an, was mit mir im Badezimmer geschieht.
ICH ERLEBE DEN ERSTEN SCHÖNEN SOMMER. Ich bin nackt. Es kommt ein Gewitter auf. Ich stehe im Regen. Ich schaue zu den dunklen Wolken hinauf. Ich sehe die Regentropfen bedrohlich auf mich zu rasen. Regentropfen klatschen in mein Gesicht. Ich erlebe das schlagende Glück. Kleine stupsende Ohrfeigen erquicken mich. Ich bebe. Ich verliere Körperwärme. Ich zittere und halte die Hände gen Himmel, will alle Regentropfen greifen, sie in meinen Handschalen sammeln, wie kleine Perlen in meiner Hand halten. Schaut euch dieses Kind wieder an. Was mit ihm ist. Sie holen mich heim. Ich sehe mich gegen meinen Widerstand ins Heim geführt, in die Wanne gesteckt, abgenibbelt, ins Bett gewickelt; und verwundere mich, sehe, was andere nicht an mir sehen. Dass ich von Muttermalen übersät bin. Dass meine Haut wie eine Blumenwiese dunkelviolett erblüht, eine Muttermalwiese ist. Alles kommt vom Wasser her, denke ich. Und also will das Kind unter keine Wasserdusche mehr kommen. Also wehrt sich das Kind mit Händen und Füßen, von der Mutter verschandelt. Führt sich hysterisch auf, der unsichtbaren Male wegen, die schmerzen, wo sie erscheinen, böse Male sind, mir die Haut von innen her verbrennen. Eine tödliche Weide, ein brennendes Hautfeld.
Читать дальше