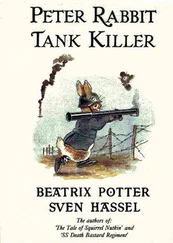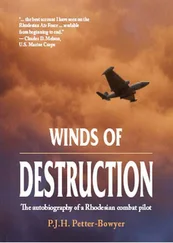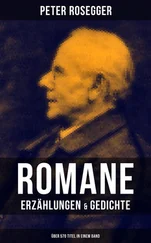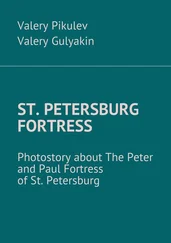DA IST DIESER WINTERTAG wieder, der mich auf dem Weg zu den Adoptionseltern sieht. Das ist der Beginn meiner Adoption. Da bin ich einiges über zehn Jahre alt. Schnee liegt in der Luft. Schnee fällt und wird Schneefall, der nicht vorhergesagt worden ist, so plötzlich aufgezogen, wo es diesen Tag für mich in die nächste Lebensrunde geht. Es schneit. Schnee ist mein Lebensbegleiter. Der genaue Weg ist mir von der Erzieherin erklärt worden: Die Straße hoch bis zur Drogerie, am Bäckerladen vorbei auf den Russenplatz zu, die erste Seitenstraße hinein und bis zum Sportplatz, dort gegenüber obere Etage. Na, bitte. Wie du das aufsagen kannst, lobt mich die Ankleiderin. Ich sage den Namen der Lehrerfamilie auf, wohnhaft in der Mittleren Allee. Ich kenne den Sportplatz nicht, habe nie zuvor von ihm gehört. Alles am Neuen ist neu. Ich lasse mich von der Erzieherin fertig ankleiden. Die Erzieherin nennt mich einen großen Jungen, dem man nichts groß erklären braucht. Ich richte mich an ihren Worten auf. Ich wachse über das Lob hinaus, dem Lob der schönen Erzieherin mit dem schwarzen, langen, dicken, festen Zopf am Rücken, den ich an ihr liebe, der ihr bis zum Hintern reicht. Ich habe gesehen, wie sich die Erzieherin mit einem Nassrasierer die Beine von Schaum frei rasierte, Spuren von Haut wie Bahnen von einem Schneeschieber frei geschoben. Schaum am Knöchel, am Rand ihrer Unterhose, die seidig glänzte. Dieselben zarten Finger kleiden mich an. Der Mund, aus dem hervor in Konzentration die Zunge der Erzieherin wuchs, die sprechende Miesmuschel, instruiert mich. Ich werde von der Erzieherin losgeschickt. Einen flüchtigen Klaps erinnere ich zu ihren Worten vor dem Treppenabsatz, mir nachgerufen: Kommst gerade recht zum Abendbrot. Wird Gutes geben bei denen. Da bin ich mir sicher, Kleiner. Mir schwante Unglück, aber ich frage nicht, warum ich den Weg allein gehen muss. Ich stürme los und gerate prompt in Schnee, von dem ich sagen könnte, er ist mir zur Hilfe gefallen, hat sich mir absichtsvoll vor die Augen geworfen, dass ich umherirre, trotz der Wegbeschreibung durch die Erzieherin den Weg zu den Adoptionseltern nicht finde. Als weißes Bemühen. Als letzte, schneetolle Behinderung. Weil die Adoption nicht glückhaft würde. Schnee fällt. Schneefall will mich aufhalten. Ich höre, sehe, fühle und vernehme die Warnung nicht. Ich renne stattdessen einzelnen Flocken nach, laufe auf Flocken zu, jage ihnen hinterdrein und drehe mich im Kreise um die Flocken, die um mich tanzen. Wie lustig die Flocken fallen und treiben, wie anders die Leute im Schneeflockenfall aussehen. Alles um mich herum ist Schnee und Wirbel. Und weiter fällt der Schnee, wird dichter. Ich komme mit dem Schneeeinfangen nicht mehr hinterher. Immer stärker fällt der Schnee über die kleine Ostseeortschaft her, leitet mich entlang meines Weges an der Friedhofsmauer vorbei, auf deren rundliche Kuppel sich der Schnee absetzt. Mit beiden Händen schiebe ich den Schnee zusammen, forme nach der ersten die nächste Schneekugel meines schönen Wintertages, klaube den Schnee vom Mauerwulst, bis mir die Finger frieren, ich sie zwischen Unterhose und Haut stecke, damit sie mir nicht abfallen. Ich weiß die Schmerzen nach der Freude wieder. Ich sehe mich auf der Stelle hopsen. Das Ziepen in den Fingern hält mich lange auf. Die Zeit ruft Ansätze zur Dunkelheit auf den Plan. Dunkelheit hinterm Schnee, hinter schneegefüllten Wolken, die aufkommen, früher als erwartet, den Tag in Nachtdunkelheit hüllen. Ich laufe an der mittleren Allee vorbei. Ich gehe hin und zurück. Ich verirre mich. Ich tapse im Schneedunkel herum, finde den Namen der Allee auf keinem Schild vermerkt, weil die Schilder mit Schnee bedeckt sind und allesamt viel zu hoch angebracht, sodass es dem Knirps, der ich bin, unmöglich ist, zu ihnen hochzuspringen, sie mit einem Handstreich von ihrem Schneebefall reinzuwischen. Auf die Idee, einen Schneeball zu formen, das Schild damit zu torpedieren, komme ich nicht, klamm, wie mir die Finger sind. Dabei kann ich gut werfen und treffen. Ich brauchte auch nur mit dem Fuß so kräftig gegen die Pfähle der Schilder treten, dass der Schnee abfällt, den Namen der Straße verrät.
Bösartig, tiefgrau verdunkelt sich der späte Nachmittag, überhäuft die Gegend mit Schnee. Alle Wege verschwinden unter einer dünnen Schneedecke. Ich irre herum, weiß nicht weiter, will nicht zurück, mich blamieren, eingestehen, mich im kleinen Ort verlaufen zu haben. Ich bin dann an der Ostsee, finde eine Treppe zum Strand hinab, stehe am Wasser, das sich gegen den Schneebefall tapfer wehrt, viel Schnee schluckt, einen dicken Schneematschteppich auferlegt bekommt. Schneefall, dem Meer als Last aufgebürdet. Schnee, der die Wellentätigkeit einschläfert, die wilde Ostsee unter seinem Gobelin still macht. Wassermassen, die sich in einen Teppich aus Schnee verwandeln. Die See ist nicht mehr vom Strand zu unterscheiden. Ich laufe über diesen gleichmacherischen Schneeteppich zur Treppe hinauf, bin wieder oben angekommen, habe mich übernommen, muss mich am Geländer halten und ausatmen. Keine Muße, die Gegend unterhalb zu bestaunen, in diese selten schöne Helle zu sehen, die bei aufziehender Dunkelheit sich auf Strand und Wasser ausbreitet. Zwischen See und Waldstück, zwischen Borke und Stamm gestellt, weiß mich die Erinnerung. Ich finde aus diesem Schnee nicht hinaus. Mein Wissen zum Schnee hilft mir nicht. Ich schneie ein. Schneeflöckchen. Weißröckchen. Wann kommst Du geschneit. Du wohnst in den Wolken. Dein Weg ist so weit. Komm. Setz Dich ans Fenster. Du lieblicher Stern. Malst Blumen und Blätter. Wir haben Dich gern. Du deckst uns die Blümelein zu. Dann schlafen sie sicher in himmlischer Ruh. Schneeflöckchen. Weißröckchen. Wie glitzerst Du fein. Du kannst gar ein Sternlein am Weihnachtsbaum sein. Schneeflöckchen. Weißröckchen. Komm zu uns ins Tal. Dann baun wir den Schneemann und werfen den Ball. Es schneit an dem Tag, der mich zum Adoptionsversuch Nummer drei auf den Weg gebracht sieht. Ich verlasse das Heim. Ich bin unterwegs, ich gerate vom Wege ab in die Irre, von Schnee umgeben, der mir nicht weiterhilft. Flockenwirbel, der mich einschneien, zudecken und von der anstehenden Adoption fernzuhalten sucht. Schnee fällt bei meiner ersten Heirat, am Tag der Geburt meines ersten Kindes, am Tag der Scheidung von Frau und Kindern und dem Tag, den ich wieder allein in meiner Berliner Wohnung bin. Schnee liegt, als der Adoptionsvater zu Grabe getragen wird. Alle wichtigen Ereignisse meines Lebens werden Schneeaugenblicke, Schneejahrzehnte. Es fällt Schnee am Ende meines Lebens. Schnee treibt vor meinem Fenster, während ich hier am Schreibtisch sitze, schneeweiße Seiten mit Schrift fülle. Schneebuchstaben. Kristallsilben. Flockenworte. Ich lasse den Schneesee Seeschnee sein, nehme die Beine in die Hand, laufe durch das Wäldchen zurück, eh mich die Dunkelheit einfängt, ihre starken Arme um mich schlingt, wie es der dicke Heinz mit den Mädchen macht, wenn es ihm in den Sinn schießt, ihnen die Oberkörper presst, die Lungenluft abdrückt bis ihnen mulmig wird, sie die Augen verdrehen und ohnmächtig zusammensacken, was dem Heinz Freude bereitet und ihn grinsen lässt, dass ich mich vor seinem Grinsen fürchte. Wo nur die Straße und das Haus des Lehrerehepaares finden, und wie nur in diesem Schneetreiben bei den Adoptionsinteressierten ankommen? Ich werde zu spät kommen, sie werden mich ins Heim zurückbringen, wo es mit mir und einer Adoption so hoffnungsvoll aussah. Dort hoch auf jenem Berge, da geht ein Mühlrad, das mahlet nichts denn Liebe, die Nacht bis an den Tag, die Mühl ist zerbrochen, die Liebe hat ein End.
Man entwickelt in den Kinderheimjahren so ein kleines Gefühl, den Kinderheiminstinkt für den Moment, wenn es mit einem so weit ist und das Glück einem freundlich auf die Schulter tippt. Ich habe mein Glück meinen guten schulischen Noten zu verdanken. Sie haben vorrangig den Ausschlag beim Lehrerehepaar gegeben. Die Situation lässt sich einfach beschreiben. Die zukünftigen Eltern sind ins Heim gekommen. Sie stößt ihn an, weist auf das aufgeschlagene Zeugnis unter der Glasscheibe im Würdigungskasten gleich hinterm Haupteingang vorm riesigen Wandteppich. Die Einsen, Zweien und wenigen Dreien. Gute Aufmerksamkeit und Mitarbeit. Hinzu kommt, dass ich ein Junge bin, Jungen eher als Mädchen zur Adoption erwogen werden, weil Jungen besser und Mädchen schlechter zu vermitteln sind, es von den Mädchen heißt, dass sie zickig sind, Schwierigkeiten machen, in der Pubertät nicht zu steuern, einfach abhauen, sich rumtreiben, auf Jungs einlassen, Pickel bekommen und Allüren.
Читать дальше