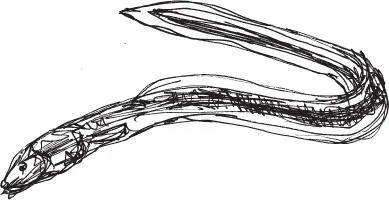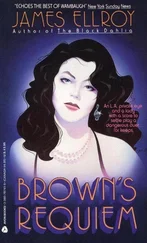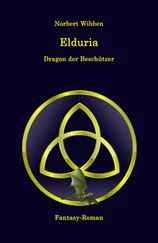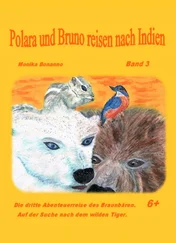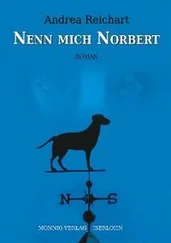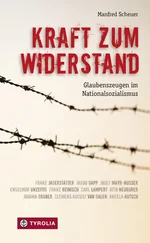Der Rauschen war endlich fertiggestellt, seine Staumauer verlief von nun an unterhalb unserer Gaststätte schräg zum Fluss, sodass auch damals bei lang anhaltender Trockenheit und niedrigen Wasserständen genügend Wasser in den Mühlengraben strömte, um das Wasserrad anzutreiben. Seither wollten immer wieder Angler, Streckenläufer oder Bauern, die ihre Felder am Ufer hatten, den großen Fisch Ichthys gesehen haben, meist im Winter am Wehr oder am Zufluss des Mühlengrabens. Vater und auch Hermann gingen oft dahin zum Eisfischen.
An der Mündung des Mühlbaches stehend, erinnere ich mich, wie ich vor langer Zeit frühmorgens im Winter aufwachte, als Hermann sich leise in unserem Zimmer anzog, um hierher zum Fischen zu gehen. Ich war damals elf, Hermann dreizehn Jahre alt. Er wollte mich nicht mitnehmen, er sagte, es sei zu gefährlich. Heimlich schlich ich hinter ihm her. Es war eisig kalt, über Nacht hatte es geschneit, ich brauchte nur seinen Fußspuren am Bahndamm entlang und dann zum Ufer hinunter zu folgen. Der Fluss war scheinbar zugefroren und gluckste leise unter dem Eis, die Zweige beugten sich vom Schnee und berührten mit ihren Spitzen die zugefrorene Wasserfläche. Oberhalb des Wehrs führten Hermanns Spuren vom Ufer auf den Fluss hinaus. Da es neblig war und es wieder zu schneien begonnen hatte, konnte ich Hermann nirgendwo sehen. Erst als ich auf dem knarrenden Eis stand, entdeckte ich ihn in der Mitte des Flusses, auf einem Hocker und in eine Decke gehüllt neben dem Eisloch sitzend. Ich sah, wie mein Bruder einen Fisch herauszog — ich hatte noch nie einen so großen Fisch gesehen. Er war größer als alles, was man je bei uns gefangen hatte, die Schuppen des Fisches waren voller Warzen und mit Moos bewachsen, er schien mir so groß wie Hermann. Mein Bruder zog den Fisch langsam heraus, betrachtete ihn eingehend, entfernte dann vorsichtig den Haken aus seinem Maul. Ich hatte den Eindruck, der Fisch würde sein Maul öffnen, um zu Hermann zu sprechen, dann setzte er ihn langsam ins Wasser zurück, hockte sich wieder auf seinen Campingstuhl neben das Eisloch und angelte weiter. Ich begriff nicht, warum Hermann den Fisch zurück in den Fluss gesetzt hatte.
Als Hermann mich auf dem Eis erblickte, rief er mir zu, ich solle vorsichtig sein, doch ich achtete trotz seiner Warnungen nicht auf das Knacken, auf Risse, die sich unter dem Schnee durch das Eis zogen, nicht auf untrügliche Zeichen dafür, dass das Eis über der Strömung noch nicht so dick war wie über ruhig fließendem Gewässer, wo Hermann fischte. Plötzlich, noch bevor ich richtig begriff, was Hermann mir zurief, brach ich krachend ein, versuchte vergeblich, mich am Rand festzuhalten, rutschte ab und tauchte unter, die starke Strömung drückte mich sofort unter die Eisdecke. Zuerst war mir kalt, als würde ich lebendig eingefroren, ich schwebte in schillernden warmen Farben durch die blitzenden Pfeilscharen, die sich im Eis brachen. Mein Bruder rannte über mich hinweg zu den Stromschnellen. Er nahm an, ich würde dort wieder zum Vorschein kommen. Ich wollte nicht gerettet werden, war glücklich — nie mehr so glücklich wie in diesem Moment —, ich weiß nicht mehr, ob ich noch bei Besinnung war oder vielleicht schon an der Schwelle zum Tod. Ich blieb in der Mitte des Flusses an den Zweigen eines Baumes hängen, seltsame Fische schwammen um mich herum, weiter entfernt lauerte der alte Fisch und glotzte neugierig zu mir herüber. Ja, ich habe ihn gesehen — vielleicht war es aber auch nur eine Halluzination, welche Rolle spielt das schon? Ich glaube mittlerweile tatsächlich, dass das, was ich damals gesehen hatte, wirklich da war. Denn ich bin scheinbar genauso verrückt wie Vater und Hermann, sonst stünde ich doch auch nicht hier im Fluss.
Hermann hatte sofort begriffen, dass ich irgendwo im Wasser hängen musste, er hatte sich an den abgestorbenen Baum in der Mitte des Flusses erinnert, kannte damals schon jede Flussströmung; er rannte zur Stelle, an der ich eingebrochen war, zog seine Kleider aus, sprang ins Wasser und tauchte bis zu mir hin. Ich sah nur das gleißend helle Licht durch das Eis glitzern, schwebte diesem Licht entgegen.
Als ich wieder zu mir kam, hatte ich Hermanns Klamotten an, mein Bruder stand nackt mitten auf dem Gleis und wollte einen Zug anhalten. Der Zug ratterte heran. Ich dachte, der würde ihn überfahren, denn er hielt erst in letzter Sekunde mit quietschenden Bremsen. Der Zugführer stürmte wütend heraus, schrie und tobte vor Hermann herum, die Fahrgäste glotzten uns beide wie Außerirdische an.
Ich gehe langsam vom Mündungsgebiet des Mühlbaches ein Stück am Ufer stromabwärts, blicke aufs Wasser, um vielleicht an der Oberfläche stehende Fische oder Spritzer von steigenden Fischen auszumachen. In Gedanken bin ich immer noch beim gestrigen Tag, sehe Zehner an der Theke sitzen, Alma, wie sie ihm Schnaps einschüttet. Die Schwestern saßen wieder mit Reese am Küchentisch, gingen wegen Zehner nicht in die Gaststätte, sie befürchteten, er würde ihnen etwas Anzügliches zurufen. Auch Alma war in die Küche zurückgekommen, sagte, dass es bei Zehner keinen Unterschied mehr mache, ob er betrunken oder nüchtern sei, er kenne weder Zukunft noch Gegenwart noch Vergangenheit, seine Gedanken zerfielen immer mehr in zusammenhanglose Bruchstücke. Abends, nachdem er die Gaststätte verlassen habe, laufe er von Unruhe getrieben umher, sein Hund führe ihn immer wieder zur Gaststätte, ohne den Hund würde er sich nicht mehr zurechtfinden. In letzter Zeit gehe er auch häufig in die Campingschenke, die hätten jetzt auch ihren Ärger mit ihm. Gestern hatte die Campingschenke ihren Ruhetag. So habe Zehner schon frühmorgens gegen die Tür getrommelt, bis sie ihm aufgeschlossen habe, dauernd klaue er Kickerbälle und verstecke sie irgendwo, spreche mit längst Verstorbenen, als säßen sie neben ihm an der Theke, und immer wieder rede er vom Krieg. Auch gestern hatte er von Soldaten erzählt, von Pferden und Kriegsmaterial, von Lokomotiven, die durch den Ort gefahren waren, von Juden und der Synagoge, die sie angezündet hatten, von Soldaten, die ihre Lieder gesungen hatten, und von unserem Tanzsaal, der zum Kriegsende hin als Lazarett gedient hatte, schließlich sprach er davon, wie sie früher auf den Wiesen vor dem Dorf Kühe gehütet hatten.
Während Zehner noch redete, ging ich ans Fenster und sah zu den Arbeitern auf der Brücke hinüber. Einer von ihnen war ein Stück am Ufer entlang bis zu einem Boot gegangen, mit dem wir früher Aale geangelt hatten. Ich war oft mit Hermann und Alma mit diesem Boot zum Aalfischen rausgefahren. Wir ruderten unter der Brücke hindurch flussabwärts, warfen mit Blut getränkte Wollknäuel ins Wasser, hockten im Boot, rauchten und warteten die ganze Nacht. Ich glaube mich an jedes Wort unserer Gespräche von damals zu erinnern, an unser sinnloses, prahlerisches Gerede, über Frauen, die Liebe und was wir später einmal machen würden. Auf dem Wasser trieben die leuchtenden Positionslichter unserer Köder, an denen die Wollknäuel hingen und auf dem Grund Aale anlockten, die sich festbissen und sich mit ihren Hakenzähnen nicht mehr befreien konnten. Manchmal hingen fünf oder sechs Aale an einem Knäuel.
Wir zogen sie ins Boot und töteten sie, indem wir ihnen das Rückgrat brachen und mit einem scharfen Messer die Köpfe abschnitten. Im Morgengrauen standen wir zwischen glitschigen, sich schlängelnden Aalleibern, ruderten zum Ufer. Während die Sonne aufging, der Nebel sich langsam auflöste, räucherten wir die Aale, tranken Bier und frühstückten am Lagerfeuer. Alma erzählte davon, dass sie eines Tages nach Paris gehen werde, um dort in einem feinen Hotel zu arbeiten; wir wollten beide mit ihr gehen.
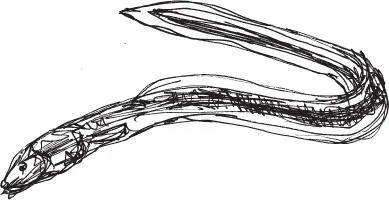
Читать дальше