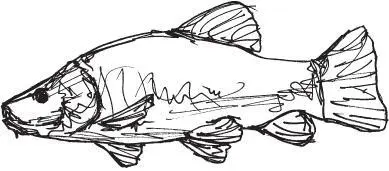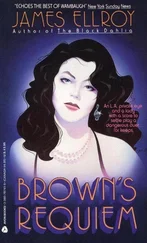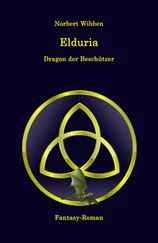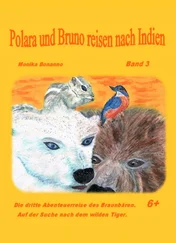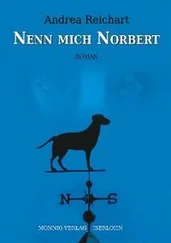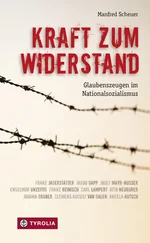Alma ging in die Küche, um die Thermoskanne aus der Kaffeemaschine zu holen. Sie kam zu mir, lächelte und sagte, sie freue sich, dass ich wieder mal nach Hause gekommen sei. Dann verschwand sie wieder in der Küche. In der Gaststätte waren alle versorgt, die meisten Märktler wieder gegangen. Die Schwestern schienen irgendwo im Haus unterwegs zu sein. Vielleicht wollten sie noch einmal mit Hermann reden oder suchten nach ihm, weil sie meinten, er sei gar nicht mehr in seinem Zimmer, sondern irgendwo am Fluss bei seinen Fischen, wie Salm und Knuppeglas behauptet hatten.
Als ich, nachdem ich die Gäste bedient hatte, zu Alma in die Küche kam, sagte sie, dass das alles überhaupt keinen Zweck mehr habe. Hermann würde, wenn er überhaupt noch in seinem Zimmer sei, die Tür doch nicht aufmachen, er habe auch seit Tagen nichts mehr gegessen.
«Ich dachte, Leo, auf dich würde er hören. Was machen wir nur, wenn Sartorius kommt?» Alma sah müde aus, ich vermutete wegen der Sorgen, die sie in der letzten Zeit mit Hermann gehabt hatte. Ich fragte mich, was sie an ihm gefunden hatte, was an ihm so Besonderes gewesen war, wieso sie ihn mir vorgezogen hatte, wieso sie nicht von hier weggegangen war, wie sie es immer gewollt hatte. Wenn sie mit uns auf dem Floß gelegen hatte, hatte sie immer von Paris erzählt, obwohl sie noch nie dort gewesen war, sie wollte nach Paris und in einem Hotel arbeiten. Wenn Belgier bei uns logierten, versuchte sie, mit ihnen Französisch zu reden. Sie hatte uns einmal erklärt, dass Arimond, der Name unserer Familie, auch französisch sei und so viel bedeute wie Adlerberg. In ihrem Zimmer hing ein Stadtplan von Paris, den sie auswendig kannte. Sie hatte Verwandte in Paris, die einmal zu Besuch gekommen waren, eine Woche bei uns übernachteten und in der Hauptsaison drei Zimmer belegten, die Alma von ihrem spärlichen Gehalt bezahlte.
Ich fragte Alma, warum sie damals nicht nach Paris gegangen sei. Sie sagte, dass Hermann und Mutter nicht ohne sie zurechtgekommen wären. «Ihr wart ja alle weg, deshalb bin ich zurückgekommen, aber wenn ich das geahnt hätte, wäre ich jetzt nicht hier. Hermann wollte doch auch nichts mehr von mir wissen, und nachdem er diese Frau kennengelernt hatte, erst recht nicht mehr. Deine Schwestern wollen mich hier raus haben. Sie machen mir Vorwürfe wegen des Zustands des Hauses, nur wenn du dabei bist, sagen sie nichts. Ich kann nichts dafür, dass es so gekommen ist, Leo. Was hätte ich denn machen sollen?»
Die Gäste wollten einen Imbiss, an der Theke musste bedient werden. Die Brückenarbeiter standen vom Frühstückstisch auf, zogen ihre Regenjacken an, setzten die Schutzhelme auf, einer kam, bevor er die Gaststätte verließ, zur Theke und tuschelte mit Alma. Nachdem die Arbeiter gegangen waren, räumte Alma ihr Frühstücksgeschirr ab, kam damit in die Küche, stellte es auf die Anrichte und begann mit dem Abwasch. Reese legte ihr Strickzeug auf den Küchentisch, schlurfte zur Anrichte, nahm ein Küchentuch und trocknete die Töpfe und Pfannen ab. Sie stellte einen schweren Gusstopf auf die Spüle, wischte ihn innen trocken, fuhr dann mit dem Tuch außen herum, stellte ihn auf die Anrichte und räumte das schmutzige Besteck in die Spülmaschine.
Während Alma und Reese spülten, saß ich allein am Küchentisch. Ich hörte die Mailbox meines Handys ab und legte es in die Rucksacktasche zurück, stand auf, ging zum Fenster und sah zum Fluss. Der Nebel überm Wasser löste sich auf, zog am Ufer entlang und verfing sich wie ein zartes Tuch im Ufergestrüpp, es nieselte leicht. Auf der Brücke holten die Arbeiter Werkzeug aus einem Pritschenwagen. Sie bohrten Löcher, spannten eine Schnur, vermaßen etwas. Alma sagte, dass die Brückenarbeiter nun schon seit zwei Wochen bei uns logierten. Die Brückenarbeiter seien sehr angenehme Gäste. Ein Zug hielt am Bahnhof. Schüler und eine Wandergruppe stiegen aus. Einige Schüler kamen in die Gaststätte zum Kickerspielen. Sie warteten auf ihren Bus, redeten darüber, dass ihr Lehrer plötzlich erkrankt und der Unterricht ausgefallen sei. Alma bat mich, die Schüler zu bedienen. Sie trugen Aufnäher des Gymnasiums, das auch Hermann besucht hatte — das Bildnis des heiligen Hermann Joseph, der die Eifel christianisiert hatte und nach dem auch Hermann, wie viele hier in der Gegend, seinen Namen erhalten hatte. Vielleicht hätte Hermann nicht aufs Gymnasium gehen sollen, vielleicht fängt das Unglück damit an, dass man Dinge lernen muss, die man nicht lernen will, dass man plötzlich in einer Welt ist, in die man nicht gehört, in der man sich völlig fremd fühlt.
Ich kann nicht behaupten, dass ich für Hermann in diesen Jahren ein guter Bruder gewesen bin, ich fing damals an, ihn zu verspotten, wie es auch meine Freunde taten — alles, was er machte und was ich früher bewundert hatte, erschien mir nun lächerlich. Eifersüchtig war ich, weil Alma sich seinetwegen von mir abgewandt hatte, sich nur noch um ihn kümmerte, dass alle sich nur noch um Hermann bemühten.
Ich bezweifle, dass unsere Mutter von diesen Vorgängen etwas mitbekommen hat, weiß nicht, in welcher Welt sie damals lebte und ob sie nach Valentins Tod noch etwas wirklich interessierte, außer ihren gelegentlichen Eskapaden mit fremden Männern. Reese jedenfalls sagte einmal, dass nach Valentins Tod ihre Lebensfreude plötzlich dahin gewesen sei. Sie habe früher viel gelacht, gesungen und Klavier gespielt, danach aber nichts mehr dergleichen getan.
Damals war mir egal, was Reese sagte, der wichtigste Mensch für mich war Alma. Ich prügelte mich ihretwegen mit Hermann, ohne dass es offen zur Sprache kam. Es war leicht, Hermann zu demütigen, er ließ sich alles gefallen, nur um seine Ruhe zu haben. Obwohl ich jünger war, war ich ihm körperlich überlegen. Ich hatte damals vor nichts Angst außer vorm Alleinsein — Angst vorm Alleinsein hatte Hermann nicht, der konnte tagelang alleine sein. Wir waren in vieler Hinsicht verschieden. Hermann zog sich mit der Zeit immer mehr zurück, während ich mich herumprügelte und Gesellschaft suchte, wenn auch keine gute.
Einer der Schüler hängte seinen Parka über die Stuhllehne und krempelte die Hemdsärmel hoch. Die anderen warteten auf ihn und drehten währenddessen ungeduldig an den Kickerstangen. Ich brachte den Jungen Cola und Limonade zum Kicker. Als Hermann auf dem Gymnasium gewesen war, hatte er jeden Tag Angst, in die Schule zu gehen, nachts redete er im Traum und wachte oft verschwitzt auf. Er konnte es Vater nicht sagen, wollte ihn nicht enttäuschen.
Zehner torkelte durch die Gaststätte und die Treppe hinunter zum Pissoir. Die Pissoirtür pendelte und schrammte über die Fliesen. Er stand vermutlich unten und pinkelte gegen die gekachelte Wand, sein Lallen schallte bis zum Gastraum hoch. Der Tabaklieferant kam herein, er hatte den Zigarettenautomaten an der Wand neben dem Eingang zur Gaststätte aufgefüllt, er trank ein Bier und spielte mit seinem Handy herum, achtete nicht auf Zehners Gerede, der nun wieder an der Theke saß. Zehner redete von der Holländerin, sie habe Sommersprossen unter den Augen und auf den Nasenflügeln gehabt, sei aus dem Fluss gezogen worden, zwischen den Zehen Schlamm, Wasserläufer mit goldfarbenen Füßchen in ihrer Hand. Er zog Kickerbälle aus seiner Tasche und sagte: «So dick und hart waren meine Eier.» — Immer wieder tickte er die Bälle gegeneinander. «… hat gelutscht, bis sie so hart waren.» Dann beschrieb er wieder, wie sie unter dem Eis aufgetaucht war, dass sie blaue Ohrenschützer trug und ihre Augen wie von Nadeln zerstochen waren. Überall in der Nähe seien Schleien gewesen, denn die Schleie sei ein Totenfisch.
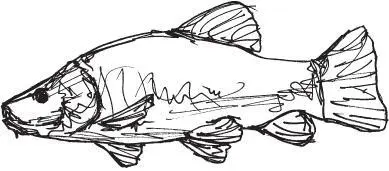
Die Schleie (Tinca tinca) hat einen gedrungenen kräftigen Körper mit hohem Schwanzstiel. Ihr Rücken ist meist dunkelgrün oder braun, die Flanken sind hell und glänzen messingfarben. Jeder Fisch hat seinen ihm zugewiesenen Platz im Fluss. So bewohnt die Schleie langsam fließendes, weichgründiges Gewässer und lebt tagsüber am Grund zwischen dichten Pflanzenbeständen. Erst in der Dämmerung wird sie aktiv. Zum Laichen schließen sich die Schleien in Schwärmen zusammen und suchen flache, durchsonnte Uferbereiche mit dichtem Pflanzenbewuchs auf.
Читать дальше