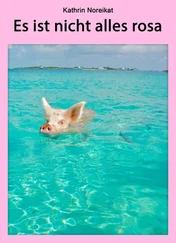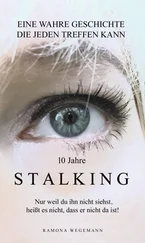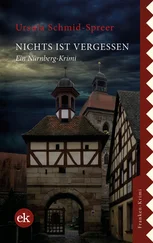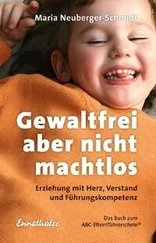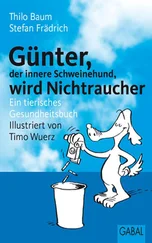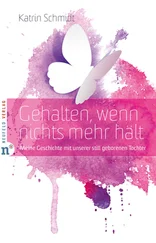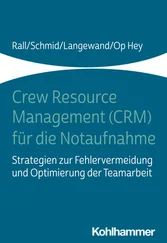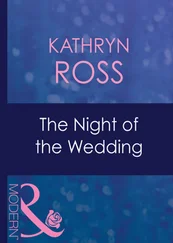Es war erst drei Monate her.

Merkst du denn nicht, dass nicht mal die Enten nicht näher herankommen wollen?
Dieser Fragesatz, von einer Mutter ausgesprochen, als ihr unten am See im Wagen geparktes Kind laut schrie, beschäftigt sie nun schon den ganzen Nachmittag. Ganz abgesehen davon, dass das Kind viel zu klein gewesen war, um einen solchen Satz überhaupt auf sich beziehen zu können, ist Helene verzweifelt, weil ihre Proben aufs Verständnis grundsätzlich misslingen. Die doppelte, die dreifache Verneinung ist ihr zu hoch, sie kommt einfach nicht hinterher.
Merkst du denn nicht?
Doch, doch, merken kann sie schon. Aber
dass nicht mal die Enten nicht näher herankommen wollen
, erschließt sich ihr einfach nicht. Was blockiert da in ihrem verdammten Schädel jegliche Logik? Sie erinnert sich, früher solche Sätze einfach von hinten aufgedröselt und schließlich, in jedem Fall! zu einem Ergebnis gekommen zu sein. Entweder war die Verneinung, doppelt oder gar dreifach, sinnig, unsinnig oder spitzfindig gewesen. Was aber bedeutet sie hier? Die Enten wollen nicht näher herankommen? Aber sie wollen doch nicht nicht näher herankommen! Was heißt das? Nicht nicht? Konfusion in ihrem Kopf, sie ist unruhig, fahrig geworden, es regt sie unglaublich auf, solche Defizite zur Kenntnis nehmen und damit umgehen zu müssen, dabei würde jeder hier, dem sie davon verschämt Mitteilung machte, nur lachen und meinen, dass es sich doch dabei um eine Lappalie handele. Dass er oder sie selbst Schwierigkeiten hätte mit doppelten Verneinungen und dass es sich nicht lohne, sich darüber aufzuregen. Wie hatte Matthes gesagt, als sie ihn auf sprachliche Defizite ansprach, die sie immer wieder bei sich bemerkt?
Ach Helene, du bist doch nur endlich normal geworden …
Das war ein Satz, der einerseits vermutlich seine Hochachtung vor ihrem Sprachvermögen ausdrückte. Andererseits fühlte sie sich durch ihn seltsam bedroht, ohne dass sie genau sagen konnte, warum. Das Gefühl der Gefahr, die von diesem Sätzchen ausging, ist ihr deutlich und präsent, sooft sie es aufruft, nur lokalisieren kann sie sie nicht. Das Nachdenken darüber gelingt nicht, es verflüssigt sich, sie stellt sich vor, dass es in den Fugen zwischen den Hirnwindungen versickert, versackt, ehe sie es hätte festhalten können. Ganz ähnlich ist es mit den doppelten Verneinungen, die ihr solches
Kopfzerbrechen
bereiten. Ja, ihr Kopf war zerbrochen, ein gutes Stück Schale war abgenommen, zum Glück sofort wieder aufgesetzt worden. Problemlos eingeheilt. Bestimmt war es für die Dauer der Operation tiefgekühlt worden. Wenn sie sich die Haare wäscht, spürt sie die Temperatur des Wassers nicht auf einem großen Teil der linken Schädelhälfte. Sie findet das eigentlich seltsam, denn die Haut hatte man doch einfach nur aufgeklappt, sie hatte doch Wärmerezeptoren, die nicht ausgeschaltet worden sein konnten während der Operation! Schiebt sie das vielleicht auf den tiefgekühlten Knochen? Dass er sich nicht erholt hat von dem Schock und die Hautrezeptoren blockiert? Jetzt schlägt sie mit der linken Hand auf den Schädel ein, wenigstens das merkt sie.
Verzweiflungsanfälle häufen sich. Seit der epileptischen Attacke, wenn sie es recht bedenkt. Noch immer hat sie den Ärzten hier nicht gestanden, dass sie das Antiepilektikum nicht mehr einnimmt. Wundert sich, dass keine Blutkontrolle ansteht, die sie von alleine auf den Trichter bringen würde. Es müsste doch überprüft werden, ob die Dosierung stimmte! Nur auf ausdrückliches Befragen hin würde sie das zugeben, nimmt sie sich vor. So schlampig, wie das hier gehandhabt wird …
Über alldem hat sie den Verzweiflungsanfall aber schon beinahe hinter sich gebracht. Womöglich ist das Entlangrennen an Gedanken, die sich aneinanderreihen wie Häuser einer endlosen Straße (man nimmt sie während der Bewegung wahr, vergisst sie aber sofort wieder), eine — oder ihre? — Methode, mit solchen Attacken fertig zu werden.
Noch fünfzehn Minuten bis zum Abendbrot. Sie hat sich eine Zeitung gekauft heute, schlägt sie auf. Auf der Berliner Lokalseite prangt ein Foto von jemandem, den sie kennt. Der
Schadhafte
sitzt da, im Rollstuhl an einem Tisch, benommen von Neugier versucht Helene zu lesen, muss innehalten, unterbrechen, von vorn beginnen, noch einmal und noch einmal, bis sie versteht.
Wojziech K., steht da, war Opfer des
U-Bahn-Schubsers
geworden, war am helllichten Tag, die Geige auf dem Rücken, von ihm vor einen einfahrenden Zug gestoßen worden. Ein begabter Geiger sei er gewesen, der seine Zeit mit Musik und Informatik verbrachte, zwischen denen er sich noch nicht hatte entscheiden können, was seine Zukunft betraf. Diese Entscheidung war ihm ja nun wenigstens abgenommen worden, denkt Helene und schämt sich auf der Stelle des Zynismus, der sich da breitmacht. Es ist ein mutloser, instinktiver Zynismus, mit tiefem Bedauern vermischt, mit einer riesigen Mitleidswelle im Bug, denn sie denkt an Bengt, den angehenden Musiker, und daran, wie unglaublich es war, auf diese Weise um sein Leben gebracht zu werden und doch am Leben bleiben zu müssen. Sie liest den Artikel noch mal und noch mal, der Täter steht vor Gericht, Wojziech K. ist als Opfer fotografiert worden, ein Bild des Täters gibt es nicht. Ob ihm das recht ist? denkt Helene, ob ihn jemand gefragt hat vor dem Fotografieren? Ein Basecap trägt er, sodass das Fehlen eines Teils der Schädeldecke nur ahnbar ist. Seine Beine sind unter dem Tisch verschwunden, und er trägt eine dunkle Lederjacke, ein Ärmel wurde in die Tasche gesteckt. Offenbar konnte er sich zum Tathergang äußern. Der Täter wurde für schuldunfähig erklärt und in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen, steht da. Stimmen habe er gehört, die ihm befohlen hätten, Leuten etwas zuzufügen, die Welt von ihnen zu befreien. Wojziech sieht so gefasst aus, nein,
mild
und
sanft
sind die besseren Worte! als könne er dem psychisch kranken Täter nachsehen, was er angerichtet hat mit ihm. Wenn sie überlegt, so hat sie ihn tatsächlich einige Tage schon nicht mehr gesehen in Heidemühlen. Nicht, dass sie ihn gesucht und nicht gefunden hätte, dennoch fällt ihr sein Fehlen nun auf. Man könnte ihn entlassen haben oder verlegt für die Prozessdauer, um die Strapazen so gering wie möglich zu halten. Sie wird ein Auge darauf haben, ob er wieder eintrifft, sagt sie sich. Wird zum Essen jedes Mal durch den linken Saaleingang gehen, am Tisch vorbei, an dem sie früher gesessen hatte, und dann auf die rechte Seite wechseln, zum Club der alten Männer. Den Umweg nimmt sie gerne in Kauf. Sie überlegt, Wojziech anzusprechen. Wenn sie es aber bislang nie getan hatte, so wäre das Prozessgeschehen auch kein guter Anlass, Kontakt aufzunehmen.
Eine geschlagene Stunde hat sie nun hier gehockt und mit rotem Kopf Zeitung gelesen, sie hat gar keinen Appetit mehr. Das Abendessen neigt sich ohnehin dem Ende entgegen. Stattdessen überkommt sie Heißhunger auf Schokolade, der Serotoninspiegel ist zu niedrig im Gehirn, muss sie denken, es ist Abend, es wird schon früher dunkel, das Hirn braucht Licht und Tryptophan, um Serotonin herzustellen. Irgendwo hatte sie das mal gelesen, komisch, dass sie es behalten hat. Sie knipst also das Zimmerlicht an, nicht nur das Leselämpchen, und wühlt im Schrank — Matthes hatte ihr gestern ihre Lieblingsschokolade, Vollmilch mit Rosinen und Nüssen, mitgegeben. (Sie ist doch tatsächlich versucht, das Tryptophan herausschmecken zu wollen, das in der Schokolade enthalten sein soll.) Schonend und liebevoll will sie es behandeln, ihr Hirn, ihm alles geben, was sie kann, um es wieder aufzuräumen, und als die Schokolade aufgegessen ist, die ganze große Tafel, sitzt sie am Fenster und wartet auf das Glück. Es kommt tatsächlich, als plötzliche Erleuchtung: …
Читать дальше