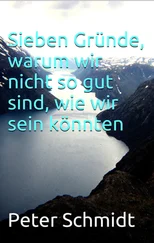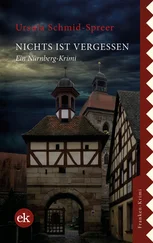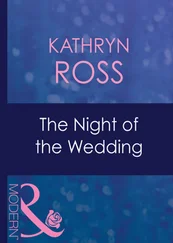stroke unit
Deshalb hatte sie sich gleich nach dem Erwachen auf bekanntem Terrain gewähnt — kein Déjà vu! Billy hatte es doch tatsächlich geschafft, Matthes hinterherzutelefonieren: In Aufregung, weil er nicht zurückgekommen war nach Hause, hatte er in Heidemühlen angeklingelt und dort von der Überstellung nach Henrichshorst erfahren. Immer noch beunruhigt, weil Matthes ausblieb, hatte er in Henrichshorst gegen Mitternacht angerufen, gerade war der Transport nach Berlin auf den Weg gebracht worden, und schließlich war er leibhaftig im Unfallkrankenhaus erschienen, um Matthes abzulösen und am Bett seiner Mutter bis zu deren Erwachen auszuharren. Matthes hatte ihn umarmt (etwas, was vor Kurzem noch undenkbar gewesen wäre, denn die Distanz zwischen ihren Söhnen und ihm hatte über die Jahre eher zu- denn abgenommen, Bill hatte ihr ziemlich gerührt davon erzählt) und war dann völlig übermüdet nach Hause gefahren. Sie hatte schließlich auch den Sohn nach Hause geschickt, war schachmatt gewesen, hatte eigentlich nur noch schlafen wollen. Aber kaum war sie eingedöst, kam auch schon eine ganze Mannschaft. Die hatte es in sich. Ein bebrillter Arzt mit zwei vorstehenden oberen Schneidezähnen hatte mit einem Zettel gewedelt, den sie unterschreiben sollte. Darauf stand, dass sie bis auf Weiteres nicht selbst Auto fahren, nicht allein in öffentlichen Gewässern baden dürfe und riskante Aktivitäten wie Bergsteigen zu meiden hätte. Sie hatte gelacht. In ihrem Zustand war an all das ja ohnehin nicht zu denken! Mit Gesten hatte sie darauf verwiesen, dass sie im Moment schlecht sprechen konnte. Dass sie benommen war. Eine Unterschrift konnte sie einfach nicht leisten. Sie wollte auch nicht, solange sie sich nicht bei klarem Verstande fühlte, aber das sagte sie natürlich nicht, sie hätte es ohnehin nicht gekonnt. Das Gefühl, dass der Arzt verärgert war wie die Mittagsschwester, wollte nicht weichen, aber ihren Magen bedrückte es nicht, sondern war dabei, sich zu einiger Selbstsicherheit aufzublasen. Sie hielt es unter der Hand für möglich, dass irgendetwas mit spitzem Grat daherkam und sie wieder platzen ließ, bemühte sich aber, über der Hand keinen Gedanken daran zu verschwenden.
Tabletten hatte man ihr mitgegeben, die sie von nun an auf unabsehbare Zeit einzunehmen hätte. Nein, das behagt ihr nicht … Sie wühlt im Täschchen, findet sie.
Ergenyl chrono
steht auf der Packung. Sie liest, dass die Dosis langsam heraufgefahren werden sollte, über vier bis sechs Wochen. Weil man ihr aber bereits Valproinsäure infundiert hat, hatte der Arzt erklärt, sei man gleich auf die Dauerdosis eingestiegen, die bei diesem Retardpräparat und unter diesen Umständen halbiert worden sei. Genau weiß sie nicht, was sie davon halten soll, hat es sich angehört, wie sie einem Gequatsche über neu entdeckte Kometen außerhalb unseres Sonnensystems gelauscht hätte, aber was bleibt ihr übrig, als es erst einmal so stehen zu lassen und abzuwarten? Wieder einmal seufzt sie laut, und nun, nach langer Zeit, seilt sich auch wieder ein dicker Spuckefaden von ihrem Mund ab. Die Zunge hat sie inzwischen etwas besser unter Kontrolle. Während der Anfälle hat sie sie tüchtig zerbissen, das schmerzt. Inzwischen kommt ihr das ganze Gesicht dick und verschwollen vor, sie hat einen blauen Fleck auf der Stirn, wahrscheinlich ist sie gestürzt. Sie schielt auf den Patientenbericht. Da steht etwas von
speech arrest
und
postiktaler Todd’scher Parese rechtsseits
Letzteres hält sie nun wieder sofort für Unsinn, da diese Körperhälfte ohnehin gelähmt ist, aber der Arrest der Worte in ihrem Kopf war ihr doch tüchtig in die Glieder gefahren. Ein Schock, ja, das kann sie wohl sagen. (Sie sagt es:
Ein Schock!
Der begleitende Sanitäter guckt verständnislos, sie lächelt kaum sichtbar …)
Man hat sie im Rollstuhl transportiert auf der Station. Man hat sie im Rollstuhl im Krankenwagen angeschnallt.
Es ist ihr egal.
Sehr plötzlich fällt ihr ein, was ihr nicht egal ist: Violas Tod. Matthes hatte ihn überbracht.
Sie zittert nicht, und sie bekommt auch keinen erneuten epileptischen Anfall. Sie ist nahezu froh, im Gallert zu stecken, denn das macht den schroff einsetzenden Schmerz beinahe erträglich.

Man lädt sie aus, setzt sie in einen anderen, klinikeigenen Rollstuhl. Man fragt sie, wie es ihr gehe. Man sieht sie an. Ist da Mitleid im Blick? Mitleid kann sie nicht leiden, ihr Gesicht verzieht sich zu gesichertem Trotz.
Aber: Sie weint.
Man fährt sie zum Fahrstuhl, hinauf in ihr Zimmer, jemand zieht ihr die Schuhe aus, legt sie aufs Bett, man fragt, ob sie eine
Erfrischung
nötig habe, ein Sandwich? Frühstücksbrötchen? ob sie Saft trinken wolle? oder Kaffee? sie verneint, verneint alles, man öffnet das Fenster, lockert den hochgeschlossenen Kragen der Bluse, man lagert die Beine hoch, jetzt sieht sie es: Wasser hat sich gesammelt, ihre Unterschenkel sind dick, elefantisch, keine Knöchel auszumachen, man überlegt, ob nicht doch lieber ein Arzt …? beschließt, damit bis zum Nachmittag zu warten, vielleicht war ja alles ein bisschen viel,
schön die Tabletten genommen? die müssen wir jetzt aber immer nehmen, nicht wahr?
, sie hasst diese Sprache, diese Sprechweise, sie bedauert es, sich nicht auflehnen zu wollen, sie will es tatsächlich nicht, es ist einerlei.
Aber: Sie weint.
Man holt eine Nackenrolle, schiebt sie ihr unter, man legt einen kalten, feuchten Lappen auf ihre Stirn, eine Schwester meint, jetzt alle zwanzig Minuten nach ihr sehen zu wollen, das müsste doch reichen, eine andere sagt, sie könnte ja immer, wenn sie aus Zimmer
264
kommt, mal hier mit reinschauen, und wie das überhaupt mit dem Essen wird?
die Frau kann sich ja augenscheinlich kaum bewegen, ein Jammer eigentlich, wenn man sich überlegt, wie gut sie vorher drauf war
(das hat sie hinter vorgehaltener Hand zu der links neben ihr Stehenden gesagt, aber Helene hat es gehört, sie staunt darüber),
na ja, das wird schon wieder, nicht?
, sagt sie jetzt laut in die Runde, setzt ein quietschvergnügtes Lächeln auf, so falsch sieht das aus, dass es Helene beinahe die Brust zerreißt, sie tätschelt ihr Gesicht, wischt sich die Hand danach verstohlen am rosa Kittel ab.
Es bleibt dabei: Helene weint.

Am Nachmittag haben sie wohl doch einen Arzt geholt. Helene sieht etwas, verschwommen. Was ist das, was sie da sieht? Einen Mann sieht sie, das ist Matthes. Einen anderen, der ihr das Päckchen mit den Tabletten auf den Bauch packt, ihre Arme nebeneinanderlegt und dann sagt, sie reagiere allergisch auf Ergenyl chrono. Sie stünde kurz vor einem Nierenversagen. Hat er das wirklich gesagt? Aus einer Tasche holt er ein Fläschchen, kleine Kügelchen darin, er macht etwas mit den Kügelchen, was sie nicht genau sehen kann, weil er ihr den Rücken zudreht. Gibt schließlich Matthes das Fläschchen, sagt, dass sie heute Abend gegen
18
Uhr das erste Kügelchen einnehmen, die Ergenyltabletten aber innerhalb der nächsten Woche ausschleichen solle. Schreibt dafür einen Plan auf. Als Matthes zweifelnd dreinschaut, sagt er nur:
Nun ja, Sie müssen wissen, wieweit Sie selbstbestimmt Patient bleiben können
Nein, wahrscheinlich ist das kein Arzt, er trägt keinen Kittel, hat Straßenschuhe an den Füßen. Jetzt zieht er eine Lederjacke an, setzt sich eine Baskenmütze schräg auf den Kopf. Helene beginnt ihn zu erkennen: Das ist der Heilpraktiker, bei dem sie im letzten Jahr mit Mareile gewesen war, als sie an einem Schmerzsyndrom beider Unterarme erkrankt war. Wie er hieß, will ihr jetzt nicht einfallen, aber sie weiß, dass er eine abgeschlossene Medizinerausbildung, die Approbation jedoch zurückgegeben hat und auf rein privater Basis behandelt. Matthes muss ihn gebeten haben zu kommen, er praktiziert in Wallersdorf, das ist gar nicht weit weg von Heidemühlen. Helene weiß eigentlich nicht, was sie von ihm halten soll. Er spricht wenig, und wenn er etwas sagt, tut er es im Brustton der Überzeugung. Widerspruch zwecklos.
Читать дальше