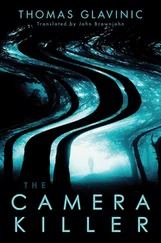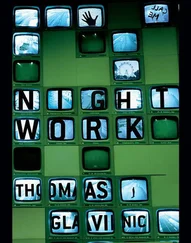In der Nacht vor dem dritten und letzten Tag des Flugangstseminars schlafe ich schlecht. Ich habe solche Angst vor dem bevorstehenden Flug, daß ich mich von einer Seite auf die andere wälze, nichts beruhigt mich, keine Tricks, keine Selbstbeschwichtigung, kein Musikhören. Ich frage mich, ob es das gewesen ist. Ob ich am Abend abstürzen, ob ich sterben werde. Auf dem Weg nach Brüssel. Oder auf dem Rückweg.
Und dann bekommt Stanislaus einen Weinkrampf. Plötzlich brüllt er auf, beginnt zu weinen, und nun ist er es, der durch nichts zu beruhigen ist. Er weint und weint und schreit immerzu:»Nein!«Und ab und zu:»Papi!«
Natürlich bedeutet das, er hat Vorahnungen. Ich werde abstürzen.
Wenigstens verstehe ich jetzt endlich, nach so vielen Jahren, den Schluß von Winnetou . Ich hatte mich schon immer gefragt, wieso Winnetou, wenn er Todesahnungen hat, sich trotzdem darauf versteift, den Kampf gegen die Ogellalah anzuführen, als erster am Seil in den Hancock-Berg hinabzuklettern, zumal ja Scharlieh ihn anbettelt, am Kampf nicht teilzunehmen, er würde die entführten Siedler schon ohne ihn befreien. Auch ich kann jetzt nicht daheim bleiben und die anderen Neurotiker allein nach Belgien fliegen lassen. Ich würde mich so elend fühlen, wenn das Flugzeug nicht abstürzt. Da gehe ich lieber das Risiko ein, daß meine bösen Ahnungen zutreffen. Denn eine kleine Chance besteht ja, davonzukommen. Nicht jede Maschine stürzt ab.
Irgendwie bekomme ich doch ein wenig Schlaf. Als der Wecker läutet, finde ich mich nicht zurecht. In der Sekunde, in der ich an den Flug denke, bin ich hellwach.
Ich ziehe mein Nacht-T-Shirt aus. Eigentlich wollte ich es zur Wäsche geben, doch jetzt fällt mir auf, was für ein Zeichen das wäre: Ich lege es ab, und ein neues liegt nicht bereit. Also werfe ich es aufs Bett.
Das gleiche im Bad, nach dem Duschen will ich mein Badetuch in den Wäschekorb stopfen. Bis mir zum Glück einfällt, daß ich ja wiederkommen will. Ich darf es mir nicht erlauben, irgend etwas fertigzumachen. Sonst wird es passieren, sonst wird Else danach überall Zeichen gesehen haben. Das Badetuch hat er weggegeben, das T-Shirt hat er weggegeben… — es war klar, er kommt nicht zurück. Nein! Ich muß mein Schicksal selbst mitgestalten. Borges hat einen Satz geschrieben, den ich schon als Kind, also lange ehe ich ihn kannte, verinnerlicht hatte, an den ich immer schon geglaubt habe:»Die Wirklichkeit pflegt mit dem Vorausgesehenen nicht übereinzustimmen. Daraus folgt, daß etwas vorhersehen soviel heißt wie verhindern, daß es eintritt. «Ich kann ihn auswendig, und ich denke oft an ihn.
Beim Kaffee sehe ich die Post durch. Ein Packen Fotos ist darunter, die Isolde Ohlbaum vor ein paar Wochen von mir in München gemacht hat. Entsetzt starre ich auf die Bilder. Ich im Regen. Mit Schirm, ohne Schirm. Ausgerechnet heute müssen sie kommen. Ein letzter Gruß, das, was übrigbleibt. What you leave behind : der Titel der letzten Folge von Deep Space 9. Ich wollte seit Jahren ein Buch so nennen. Das, was du zurückläßt. Else wird sagen: Und genau an dem Morgen sind die Bilder gekommen. Als ich die Nachricht gehört habe, lagen die Fotos vor mir. Ich habe sein Gesicht gesehen und gedacht…
Gegen das T-Shirt und das Badetuch konnte ich etwas unternehmen. Die Fotos kann ich nicht schlagen. Die sind gekommen, und ich kann sie nicht abwehren.
Beim Abschied stehen Else und ich herum, offenbar weiß auch sie nicht recht, was sie sagen soll. Ich muß unentwegt schlucken, Stanislaus hängt sich an mein Hosenbein, ich hebe ihn hoch und gebe ihm einen Kuß. Er sagt:»Auf Wiedersehen, Papi!«
Im letzten Moment kommt mir der richtige Gedanke. Ich gehe noch mal in die Küche und stecke die Fotos ein. Wenn sie bei mir sind, kann Else sie nicht gesehen haben, als die Nachricht usw…, also besteht Hoffnung, daß die Nachricht überhaupt nicht kommt, weil ich ja die Fotos bei mir habe.
Auf dem Weg zum CAT, dem City Airport Train, bekomme ich Bauchweh. Was, wenn das so weitergeht? Im Seminar kann ich das nicht brauchen, und im Flugzeug schon gar nicht.
In der Apotheke kaufe ich eine Schachtel Kohletabletten, im Zeitschriftenladen daneben die Presse . Heute sind die ersten Seiten von Die Arbeit der Nacht vorabgedruckt. Mit einem Foto von mir. Aber dieses Bild ist etwas anderes, das nehme ich positiv. Heute, an dem Tag, an dem ich fliege, wird mein Roman erstmals von vielen Menschen gelesen, das ist ein gutes Omen, jedenfalls für den Roman. Abstürzen sollte ich allerdings nicht, das wäre auch für den Roman ein schlechtes Vorzeichen.
Ich habe nicht das Gefühl, es sei mein letzter Tag. Aber welche Gewähr bietet dieses Gefühl? Ich bin nicht Winnetou, ich ahne nicht. Oder wenn, vielleicht falsch.
Am Flughafen. Gut sieht keiner aus. Mike, mit dem ich mich an den vergangenen Tagen ab und zu ausgetauscht habe, erzählt mir, er sei seit halb fünf wach. Der Mann, den wir den Mönch nennen, hat seine Selbstsicherheit verloren, er tritt von einem Fuß auf den anderen und redet nichts. Überhaupt gibt es plötzlich kaum noch Kommunikation, alle sind mit sich selbst beschäftigt. Der Blonde mit dem Silberblick, der immer die Fäuste ballt, in dessen Gesicht es zuckt und der aussieht, als würde er uns alle töten wollen, uns, weil niemand anderer da ist, er würde jeden nehmen, dieser Mann macht einen so bedrohlichen Eindruck von Grenzgang und Überforderung, er strahlt etwas so Zerrüttetes, Krankes, Verschobenes und Wildes aus, daß ich gar nicht mehr wegschauen kann und sogar meine Angst vergesse. Dieser Mensch ist so offenkundig gestört, richtig und wirklich gestört, mir ist es ein Rätsel, wie er in der Gesellschaft bis jetzt funktionieren konnte.
Wir steigen in ein im Hangar stehendes Flugzeug. Zur Ansicht, zur Vorbereitung, es ist nicht das, mit dem wir fliegen. Ein Airbus 330. Die Angst kommt wieder, aber mein Gehirn spielt allmählich nicht mehr mit. Es weigert sich, dauernd Angst zu haben, und so marschiere ich recht teilnahmslos, ja benommen durch die Maschine. Die Männer lassen sich im Cockpit die Technik erklären. Mich interessiert das kein bißchen, ich bleibe hinten in der Business-Class bei den Frauen. Eine dicke alte Spanierin hat ihr Namensschild so an ihrer Bluse befestigt, daß sein Gewicht diese hinunterzieht, ich weiß gar nicht, wo ich hinschauen soll vor lauter Dekolleté.
Ich höre mich ein wenig um. Eine Frau hat das Seminar von ihren Kindern zum Geburtstag geschenkt bekommen, eine andere will ihren Sohn, der nach London gezogen ist, regelmäßig besuchen können, eine dritte ist einfach nur neugierig. Ich rede mit diesen Menschen, mit denen mich nichts verbindet, und habe dabei ständig eine Frage im Kopf: Sind das Menschen, die bei einem Flugzeugunglück ums Leben kommen werden?
Mittags kommt ein SMS von Daniel: Hab keine Angst, es ist wie Busfahren.
Schon wieder dieser Busvergleich. Ich finde das ja nett, aber gleichzeitig weiß ich, daß Fliegen eben nicht wie Busfahren ist, denn sonst würden übergewichtige Bauernlümmel in den Cockpits sitzen. Es muß einen Grund haben, warum sie nur Helden und Genies an den Steuerknüppel lassen.
Am Nachmittag verschlechtert sich mein Zustand. Ich kann fast nicht mehr reden. Es ist der Mund, er geht nicht mehr auf. Ich bin müde.
Wir sitzen mit den Piloten und der Chefflugbegleiterin in einem Seminarraum und besprechen den bevorstehenden Flug. Die Frauen wollen von der Flugbegleiterin wissen, wie der Job ist, sie machen Ah und Oh, sind fasziniert und scheinen ihre Angst zu vergessen. Die Männer sitzen schweigend da und schauen beim Fenster raus. Oder auf ihre Schuhe. Oder haben die Augen geschlossen. Wie der Silberblickmann, in dessen Gesicht es unablässig zuckt, und um den ich mir Sorgen machen würde, wäre ich dazu noch in der Lage.
Читать дальше