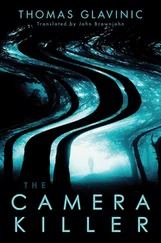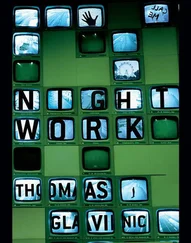Wir reden über meine Flugangst. Else hat ja auch Flugangst, aber sie überwindet sie, ich hingegen bin seit 1983 nicht geflogen, da war ich elf. Sie rät mir dringend, ein Seminar zu besuchen, denn sie will endlich mit mir Städtereisen unternehmen und nicht immer nur Kurzurlaub in irgendeinem Thermenhotel in der Oststeiermark machen.
«Du meinst, Fliegen ist sicher?«
Else sieht mich scharf an, es ist der Ich-sag-dir-jetzt-was-Blick:»Ein Linienmaschinenpilot, weißt du, was der für einen normalen Piloten ist? Ein Au-to-bus-fahrer!«
Mir geht es allmählich besser. Else geht es auch gut, weil sie zu Hause mit Ursel auch eine Flasche getrunken hat, und bald geht es uns beiden so gut, daß wir uns von einem Taxi zum Hotel Orient bringen lassen. Eine Stunde später fahren wir wieder nach Hause. Das heißt, Else fährt nach Hause, ich steige eine Straße vorher beim D-Zug aus.
Was steht mir bevor, wenn das Buch erscheint? Schon wieder taucht dieser Gedanke auf. Schaffe ich es auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises? Unter die ersten Sechs? Da muß ich es vorher erst mal unter die ersten Zwanzig schaffen, also auf die Longlist. Wäre schön, denn ein Erfolg kann mich materiell weitgehend sorgenfrei machen, zumindest für eine Weile, ein Mißerfolg hingegen hat nicht nur auf mich, sondern auch auf Else und indirekt auf Stanislaus negative Auswirkungen. Ich erinnere mich noch gut daran, wie mein erster Verleger, als mein erster Roman erschien, mir erklärte: Ein Buch muß krachen . Seit Wochen laufe ich im Kreis. Ich denke immer dasselbe. Zeitungsartikel, Fernsehauftritte, Lesungen, und dabei abwarten, ob es kracht. In jeder Saison lassen es nur sehr wenige Romane krachen.
Ich trinke White Russians, ab und zu lädt mich Werner auf einen B-52 ein, und ich revanchiere mich. Langsam wird es rund um mich finster. Ich gehe pinkeln, danach wasche ich mir am Gang die Hände, die Tür zur Damentoilette fliegt auf, Judith und irgendein Kerl kommen heraus. Sie kichert, als sie mich sieht. Ich bin zu betrunken, um mir darauf einen Reim zu machen, mir ist es im Grunde egal, was andere Leute tun.
An der Theke unterhalte ich mich mit Werner. Mir fällt eine Geschichte ein, die ich seit Jahren anderen Schriftstellern erzähle. Ich behaupte, Schriftsteller seien besondere Schützlinge Gottes, er schätze sie besonders, das stehe in der Bibel. Manchmal erzähle ich auch, es sei Jesus, der die Schriftsteller besonders liebe. Egal, welche Version ich erzähle, ich erlebe immer die gleiche Reaktion: Jeder Schriftsteller horcht auf, selbst der zynischste Misanthrop, jeder staunt und fragt erfreut: Ach ja? In welchem Widerspruch diese Behauptung zur christlichen Lehre steht, in der alle Menschen gleich viel wert sind, fällt keinem auf, alle, alle, alle freuen sich. Und deshalb erzähle ich sie noch immer.
Aber wieso ist mir das jetzt eingefallen?
Ich erzähle die Geschichte Werner, ich erzähle ihm auch, daß sie nicht stimmt, und frage ihn, ob er weiß, warum sie mir eingefallen ist. Er weiß es auch nicht.
Judith geht schon wieder in Begleitung aufs Klo, diesmal ist es ihr Freund.
«Was ist denn da los«, sage ich zu Werner,»ich will ja nicht Moralapostel spielen, aber zuerst der eine… dann wieder ihr Freund… also ich weiß nicht…«
Werner fährt sich mit dem Zeigefinger an den Schnurrbart und zieht die Nase auf.
«Ach sooooo«, sage ich. Ich höre wieder den Betenden. Zwei Schwule kommen herein.
Als ich mittags in die Küche komme, ist meine Mutter zu Besuch. Ich winke ihr einen Gruß zu, sie winkt zurück, sie ist gerade mitten im Erzählen einer Geschichte, die sich ihrem Ton nach schon einige haben anhören müssen. Mit einer bewußten Willensanstrengung schließe ich die Ohren, ich öffne sie wieder, als Else neben mir steht und mich fragt, ob sie mir Rührei machen soll. Ich schüttle den Kopf, statt dessen wärme ich mir zwei Tütensuppen, asiatisch.
«Wißt ihr, was mir imponiert?«fragt meine Mutter ansatzlos.»Wenn jemand ›Sie…‹ sagen und dann furzen kann.«
Else und ich schauen uns an. Sie sagt übrigens nicht furzen , sie drückt es landschaftlicher aus.
«Nicht daß ich es gutheiße«, versichert meine Mutter,»ich finde es nur imponierend, wenn jemand auf Kommando furzen kann.«
Mit meinen Suppen und meinem Kaffee verziehe ich mich ins Arbeitszimmer. Ich nehme ein Aspirin. Ich setze Kopfhörer auf und höre Musik, Stereolab, mit voller Lautstärke, doch es ist nicht laut genug, um nicht in gewissen Abständen das hysterisch-wahnsinnige Gelächter meiner Mutter aus der Küche zu hören.
Posteingang: (0)
Ich durchsuche meine Taschen nach den Notizen der vergangenen Nacht. Wenn ich allein trinke, fallen mir über einen bestimmten Zeitraum allerhand geniale Dinge ein, die ich auf Gasthausrechnungszetteln notiere. Gestern war ich im a² , und ich glaube mich zu erinnern, daß ich mir wichtige Dinge notierte, ehe ich begonnen habe, mit den Kellnern armzudrücken (Armdrücken ist bei mir immer Indiz für das Erreichen des Stadiums totaler Gottlosigkeit und Stumpfheit). Aber wo sind die Zettel?
Das Telefon läutet, ich erkenne die Nummer sofort: der Absender des Galatasaray-SMS. Jetzt ruft er also an. Mein Herz schlägt schneller, erst will ich ihn abweisen, aber dann hebe ich doch ab, das Weglaufen und Nichtkonfrontieren muß ein Ende haben.
«Hallo, hier Klaus«, höre ich.
Und brauche ein paar Sekunden, bis ich kapiere, daß ich mit dem Mitarbeiter der Wiener Village Voice rede.
Mit weniger als einem halben Ohr höre ich zu. Er will einen Text von mir. In meinem Kopf arbeitet es. Wieso bitte hat mir der Mitarbeiter der Wiener Village Voice ein ausländerfeindliches SMS geschickt? Der ist doch alles, nur kein Nazi. Ich kontrolliere die Nummer, sie stimmt.
«Klaus, wir müssen reden.«
Ich erzähle ihm die Geschichte. Als er hört, ich hätte ihn für einen mich verfolgenden Nazi gehalten, ist er betroffen. Galatasaray sei ein kreativer Witz gewesen, er habe sich dabei nichts gedacht.
«Du hast doch meine Nummer, du weißt doch, daß ich das bin«, sagt er. Ich muß ihm erklären, daß ich damals bei Heidis Party in einem Anfall von Literaturbetriebswiderwillen auch seine Nummer gelöscht habe. Komme mir ziemlich blöd vor.
Die Zettel vom Vorabend, wo? Ich finde sie neben dem Laptop. Dadurch erinnere ich mich, daß ich nach dem Nachhausekommen noch» Gedichte «geschrieben habe. Ich lösche sie, ohne sie anzusehen, dann lese ich die Notizen, vielleicht ist etwas Brauchbares dabei.
«Wo Handy gekauft? Nicht verdächtigen, aber gestohlen.«
«Glavinic der bessere…«
«Länger nicht schreiben ist wie länger keinen Sex haben.«
«Ein Schriftsteller ist ein Soldat!«
«Durch Schach habe ich«
«Steirische Landesausstellung 1984«
«Vater Kohl Daniel«
«Egal, wo Menschen zusammenkommen (Film etc.) — sie schlafen miteinander«
«Story: Homophiler, politisch korrekter Typ schlichtet Streit (verteidigt Schwule), wird zus.geschlagen, von 2 Schwulen mitgenommen, helfen verarzten ihn, Pflege ihre Wohnung, dann ihn festgebunden und in den A. gef.«
«Mit einem (unleserlich) Pluto (?) ausschalten«
«dünne Frauen Heuschrecken«
«(unleserlich) aus unserer Mitte«
«(unleserlich) Motiv Herz — Narr — (unleserlich) — N: V:T«
(plus sechs nicht mehr entzifferbare Notizen)
Einiges ist selbsterklärend, einiges rätselhaft, schade, daß ich so viel nicht lesen kann. Vielleicht war etwas Brauchbares dabei, wenngleich der Anschein nicht dafür spricht. Die» Story «werde ich jedenfalls nicht schreiben. Was einem alles einfällt. Und was ist mit Daniel oder Daniels Vater oder Kohl? Helmut Kohl?
Ich rufe Daniel an, vielleicht kann er sich die Sache erklären. Er ist gerade in New York, bei ihm ist es früh am Morgen, trotzdem hebt er gleich ab. Er kann mir auch nicht helfen, er hat vor dreißig Stunden eine Ecstasy-Tablette geschluckt und ist nicht recht zugänglich. Ich nehme mir vor, ihn in zehn Stunden noch einmal anzurufen.
Читать дальше