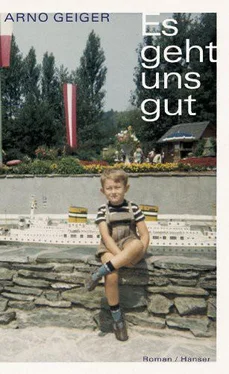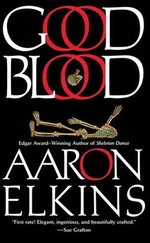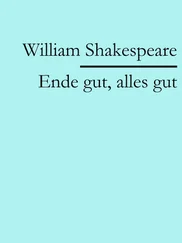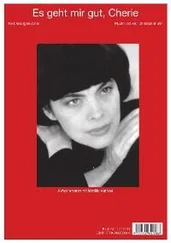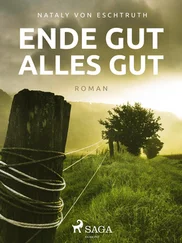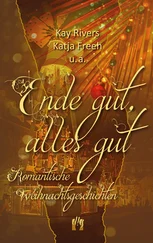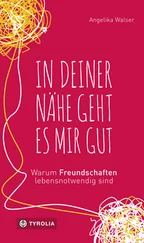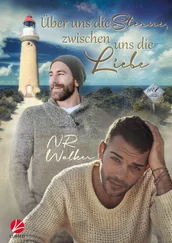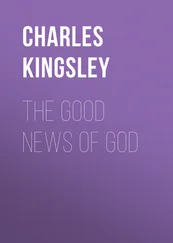Die Probleme begannen in den Jahren des zweiten Studienabschnitts, als Ingrid bis an den Rand des Nervenzusammenbruchs schuftete und von Peter keine Unterstützung bekam. Das ging schon in Hernals los, noch bevor Peter die Lizenzen seiner Spiele verkaufte. Mit dem Verkauf der Lizenzen Ende 1960, während der Schwangerschaft mit Sissi, hoffte Ingrid, daß jetzt ein besseres Leben beginnen werde. Statt dessen wurde es schlimmer. Ingrid lag im Krankenhaus, Peter war beruflich unterwegs, weil er seine Straßenkreuzungen zu fotografieren hatte. Sie preßte und schwitzte, und von draußen drang ständig Schlagergesang von einem Frühschoppen herein, Trude Herr, Vico Torriani, das machte sie ganz fertig. Dann Peters viel zu kurze Besuche auf der Wochenstation und die Behauptung, daß es über seine neue Arbeit nicht viel zu erzählen gebe. Die vielen einsamen Spaziergänge am Wilhelminenberg mit dem Kinderwagen und später das langweilige Entenfüttern mit Sissi, als Ingrid eigentlich hätte lernen sollen. Einmal, da waren sie zu viert beim Konsum, 1965 oder Anfang 1966, Philipp war noch kein Jahr, und Sissi mußte speiben, genau auf Philipp in den Kinderwagen und auf die Waren, die Ingrid dort abgelegt hatte. Philipp schrie wie am Spieß. Und Peter? Lief rot an bis unter die Haare, schaute sich um, ob jemand ihn und seine Familie beobachtete. Vorsorglich nahm er zwei Schritt Abstand, um seinen fehlenden Anteil an der Misere für jedermann kenntlich zu machen. Wenn etwas schiefging, war immer Ingrid schuld, weil Peter sich ja einen Dreck um etwas kümmerte. Schöne Logik. Ingrid könnte Dutzende Beispiele nennen, lauter Dinge, die sie nicht vergessen kann. Ihr geht es da wie einem Elefanten, jedenfalls solange diese Vorfälle nicht verarbeitet sind. Und verarbeiten kann sie erst jetzt. Denn erst jetzt, seit Philipp im Kindergarten ist, findet Ingrid wenigstens manchmal die Zeit, sich die Gedanken zu machen, die sie sich schon damals dringend hätte machen müssen. Die Crux bestand darin, daß sie in dem Strudel aus Alltagssorgen nicht zur Besinnung kam und deshalb das Ausmaß, wie wenig Unterstützung sie von Peters Seite erhielt, gar nicht zu würdigen wußte. Eben weil sie sich alleine durchboxen und drüberhanteln mußte. Die Angst, sich vor den Eltern eine Blöße zu geben, tat den Rest. Und so, zwischen Hammer und Amboß, vergingen die Jahre.
Nicht einmal eine Hilfskraft für die Kinder oder den Haushalt gelang es ihr durchzusetzen. Peter legte sich wiederholt mit dem Argument quer, er hasse diese semifamiliären Bindungen, er wolle nicht parat stehen für fremde Leute und jederzeit den Chauffeur machen müssen. Damit hatte es sich. Das Angebot ihres Vaters, das Kindermädchen von der Steuer abzusetzen, indem er es als Hilfskraft beim Ordnen seines Nachlasses führt, kam gar nicht zur Diskussion. Und Ingrid hatte es auszubaden. Wären nicht Frau Andritsch und die anderen Nachbarinnen gewesen, sie hätte sich aufhängen können.
Sie war jung, auch wenn sie sich damals nicht gar so jung vorkam: zwanzig, zweiundzwanzig, vierundzwanzig. Sie sah nicht annähernd und wollte vielleicht auch nicht sehen, was sie ruhig ein wenig kritischer hätte unter die Lupe nehmen dürfen. Es ist ja nicht so, daß sie nicht gewarnt worden war. Selber schuld, kann sie nur sagen. Denn sie muß zugeben, vieles hat sie sich vorgemacht. Das große Glück zum Beispiel — wenn sie ehrlich ist, gab es das nie.
Und jetzt: Jetzt muß sie mit den Konsequenzen leben. Sie muß das Beste daraus machen, obwohl es keine leichte Aufgabe ist, Peter in seiner freundlichen, unbekümmerten, konsequent distanzierten, eingefleischt gleichgültigen Art zu lieben.
Fortsetzung: In seiner grundanständigen, gutmütigen, selbstgenügsamen, nein, anspruchslosen, in seiner alles verharmlosenden und vieles herunterspielenden, von Not und Krieg gelehrten, defensiven, kontaktscheuen undsoweiter undsoweiter —.
Aus der Verjüngung der Allee Richtung Neptun-Grotte dringt Gelächter und Geschrei. Augenblicke später biegen Jugendliche in Ingrids Gesichtsfeld, die sich auf italienisch unterhalten. Zwei Paare bilden sich. Ohne Musik tanzen sie im Walzerschritt die Allee herunter. Schnee quietscht unter ihren Füßen, sie lachen und stoßen» Auguri!«-Rufe aus. Cara bellt. Sissi schaut blauäugig, Philipp steht der Mund offen, ein wenig empört. Ingrid hat eine riesige Freude, sie strahlt mit den Jugendlichen, wirft ihren roten Schal, der gut zu ihren vielen Haaren paßt, zurück über die Schulter und dreht sich ebenfalls zweimal. Mit einem Luftpartner und der Zigarette in der Hand. Das erste Mal an diesem Tag, daß sie das Gefühl hat, der Boden unter ihren Füßen ist fest.
Wien und Walzer, früher (früher!) war das für sie ein Begriff.
Als die Laternen angehen, sind sie wieder zu Hause. Peter empfängt seine Familie unter der Tür, so kann Cara ins Haus und Tapser bis in die Küche machen. Ingrid, die ihren feuchten Mantel aufknöpft, bekommt einen Kuß, nicht gerade einen Kinokuß. Aber immerhin. Sie freut sich darüber, zumal sie vom geisterhaften Tanzen der Jugendlichen nach wie vor halb abwesend ist. Es kommt noch besser: Gefragt, was um Himmels willen in ihn gefahren sei, ob er den ganzen Marillensekt weggetrunken habe (er verneint), schwingt Peter sich zu dem Bekenntnis auf, daß er sich ein Leben ohne sie drei nicht mehr vorstellen könne. Auch das tut Ingrid gut, obwohl Peter damit zu verstehen gibt, daß er Frau und Kinder als Personalunion begreift.
Peter hilft den Kindern aus den Stiefeln. Er berichtet von den Telefonaten, die er geführt und entgegengenommen hat.
Er sagt:
— Trude läßt fragen, ob wir einen Kalender brauchen. Sie schickt uns einen.
— Das ist nett, daß sie an uns denkt.
Als Ingrid die Kinder in die Badewanne steckt, bringt Peter sogar eine Tasse Kaffee mit warmer aufgeschäumter Milch. Sehr aufmerksam. Er ist wie verwandelt.
Wie verwandelt? Natürlich, Ingrid kennt die dahintersteckenden Mechanismen aus jahrelanger Erfahrung. Für den Moment sind Peters Annäherungsversuche und Versöhnungsgesten trotzdem ganz angenehm. Sie ist ja immer schnell zu erweichen. Den Wunsch, daß es wieder besser wird, hat sie schon aus dem pragmatischen Grund, weil es die Kinder gibt. Sie hofft halt, daß keines von ihnen Peters partnerschaftliche Minderbegabung geerbt hat. Gleichzeitig hofft sie natürlich auch, daß die Zwanghaftigkeit, mit der Peter sich in Nebensachen vertieft, nicht an die beiden übergegangen ist. Damit würden die Ärmsten schlecht fahren.
Sie meint Peters Basteln in der Werkstatt und die Spiele, von denen er nicht abgelassen hat, bis ihm nichts anderes mehr übrigblieb. Schlagende Beispiele in puncto radikaler Nebensachen. Für Ingrid hatten die Spiele am Anfang Freiheit und Abenteuerlust und Kreativität und Wille zur Selbstbehauptung signalisiert. Aber bis auf die Sache mit der Selbstbehauptung hat Ingrid das ziemlich falsch eingeschätzt. In Wahrheit war es eine Fortsetzung des Tschick-Sammelns in der Erbsenzeit, ein während der ersten Nachkriegsjahre entstandenes, aus der Not geborenes, völlig ineffizientes, letztlich sinnloses Unternehmen, mit dem Peter sich beschäftigte, um größeren Plänen aus dem Weg gehen zu können.
Wer kennt Österreich?
Ingrid denkt: So langsam, doch, so langsam mache ich mir ein Bild.
Sie seift den Kindern die Köpfe ein und spült ihnen das feine, leichte Haar, wie es schon ihre eigene Mutter gemacht hat, als Ingrid und Otto gemeinsam in der Wanne saßen. An Otto erinnert Ingrid sich nicht mehr sehr gut. Aber sie weiß noch, daß ihre Mutter Otto Waschbär nannte und sie (Ingrid, Gitti) Iltis . Sie nennt Philipp Waschbär und Sissi Iltis . Die Kinder stoßen ihre schrillen Lacher aus, und weil Ingrid vom Dienst und vom Spaziergang ziemlich geschlaucht ist und weil sie von der Kälte ein wenig Kopfweh hat, überredet sie die beiden zu einem Wettbewerb, wer länger untertauchen kann. Die Kinder halten sich die Nasen zu und saugen auf Fertig!Los! mit aufgerissenen Mündern die Luft ein. Ehe sie mit den Hintern zur Badewannenmitte rutschen und mit den Oberkörpern unter Wasser fallen, kneifen sie fest die Augen zu. Ihre Gesichter mit den trompeterdicken Wangen sehen unter Wasser schlierig aus, verschwommen durch die Seife, perspektivisch vergrößert. Ingrid denkt an Fische, die man unter einer Brücke schwimmen sieht. Das Kreischen der Straßenbahn auf der Pötzleinsdorfer Straße ist jetzt ebenso vernehmbar wie das Ticken in der Gastherme.
Читать дальше