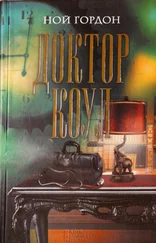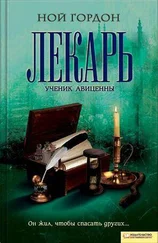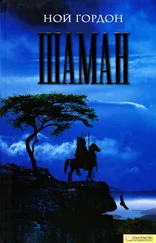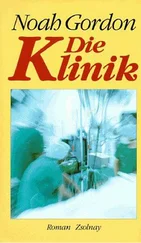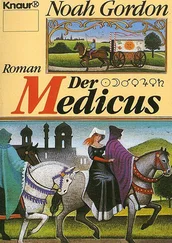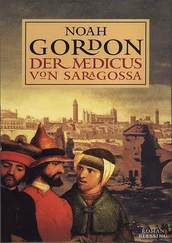»Dabei zahlen wir ihm ohnehin nur einen Hungerlohn, gemessen an den Einkünften, die er aus seinen Kollekten bezieht«, sagte Nance.
»Und je stärker diese Stadt ihren Ruf als gottesfürchtige Gemeinde ausbaut, desto billiger kommen wir weg.«
»Verdammt noch mal, da gibt es nichts auszubauen«, sagte der Richter. »Das ist eine gottesfürchtige Gemeinde, wenn doch sogar schon die Juden ihre Gebetsmeetings abhalten.« Keiner erwiderte etwas. »Entschuldige, Dave«, sagte er höflich.
»Keine Ursache«, sagte Schoenfeld leichthin.
Aber noch am selben Abend rief er Ronnie Levitt an. »Die Geschichte mit dem Tempel geht mir nicht aus dem Kopf«, sagte er.
»Ich glaube, wir sollten uns noch einmal zusammensetzen und die Sache besprechen, meinen Sie nicht?«
Sie machten ein kleines Gebäude in gutem Zustand ausfindig und kauften es. Dave und Ronnie steckten je fünftausend Dollar in den Kauf des Hauses und der zwei Morgen großen Grundparzelle. Es war vereinbart, daß die jüdische Gemeinde eine Summe aufbringen werde, die für die Renovierungsarbeiten und das Gehalt des Rabbiners reichte.
Zögernd schlug Ronnie Levitt vor, den Tempel Sinai zu nennen.
zögernd stimmte Dave zu. Es wurde kein Einspruch erhoben. »Ich fahre nächsten Monat nach New York zu Besprechungen mit meinen dortigen Zeitungsleuten«, sagte Schoenfeld. »Dabei werde ich sehen, ob ich einen Rabbiner auftreiben kann.«
Vor seiner Reise korrespondierte er mit einem Menschen namens Sher, und in New York rief er dann die Union of American Hebrew Congregations an und lud den Rabbiner für den nächsten Tag zum Mittagessen ein. Erst nach dem Gespräch fiel ihm ein, daß jener als Geistlicher vielleicht nur koscher essen dürfe. Aber als sie im Büro der Union zusammentrafen, machte Rabbi Sher keinerlei diesbezügliche Andeutungen. Unten im Taxi beugte sich Dave zum Fahrer vor und sagte nur: »Voisin.« Er warf einen raschen Blick auf Rabbi Sher, aber dessen Gesicht blieb gelassen.
Im Restaurant bestellte er Hummercrêpes. Der Rabbi bestellte Huhn saute echalote, und Dave erzählte ihm grinsend, daß er sich schon Vorwürfe gemacht hatte, nicht in ein jüdisches Restaurant gegangen zu sein.
»Ich esse alles außer Muscheln und Schnecken«, sagte Sher. »Ist das Vorschrift?«
»Durchaus nicht, eine Sache der Erziehung. Jeder reformierte Rabbiner hält das, wie er will.« Während des Essens sprachen sie über den neuen Tempel.
»Wie hoch würde uns ein eigener Rabbiner kommen?« fragte Schoenfeld.
Rabbi Sher lächelte vor sich hin. Dann nannte er einen Namen, der zwei Dritteln der Juden Amerikas vertraut war. »Für ihn zahlen sie fünfzigtausend im Jahr, oder mehr. Für einen jungen Absolventen der Rabbinerschule sechstausend. Für einen älteren Rabbiner, den man in keiner Gemeinde behalten hat, auch sechs. Und für einen guten mit einigen Jahren Erfahrung auf dem Bukkel vielleicht zehn.«
»Vergessen wir den ersten. Können Sie mir aus Kategorie zwei bis vier ein bis zwei Namen nennen?«
Mit Sorgfalt brach der Rabbiner sein knuspriges Brötchen. »Ich kenne da jemand sehr guten. Er war kurze Zeit Hilfsrabbiner in einer großen Gemeinde in Florida und hat dann eine sehr weit verstreute Gemeinde in Arkansas betreut. Er ist jung, energisch, eine gute Erscheinung und ein gescheiter Mann.«
»Wo ist er jetzt?«
»Hier in New York. Er gibt Kindern Hebräischunterricht.«
Schoenfeld blickte ihn scharf an. »Hauptberuflich?«
»Ja.«
»Wieso?«
»Es ist nicht ganz leicht für ihn, eine Gemeinde zu finden. Vor einigen Monaten hat er ein bekehrtes Christenmädchen geheiratet. «
»Eine Katholikin?« »Ich glaube nicht.« »Diese Heirat wird bei uns keinen Menschen stören«, überlegte Schoenfeld. »Wir Leben mit unseren Christen in recht gutem Einvernehmen. Und solange dem Mann das Wasser bis zum Hals steht, könnten wir ihn doch für siebentausend kriegen - oder meinen Sie nicht?«
Irgend etwas, Schoenfeld wußte keinen Namen dafür, huschte über die Züge des Rabbiners. »Das müssen Sie schon mit ihm selbst ausmachen«, gab Sher höflich zurück.
Schoenfeld brachte ein in Leder gebundenes Notizbuch zum Vorschein und griff nach seiner Feder. »Wie heißt er?«
»Rabbi Michael Kind.«
26
Bei einem Autohändler in Bronx erstanden sie einen blauen Plymouth, ein zwei Jahre altes Kabriolett, aber mit fast neuen Reifen. Dann fuhren sie damit zurück zu ihrer Wohnung in West 60th Street und veranlaßten die Bahnspedition von Leslies Schreibtisch und ihrer beider Bücher.
Es gab noch ein letztes unbehagliches Abendessen bei seinen Eltern.
Der Abend zog sich hin und war beschwert mit all den gesagten und den ungesagten Dingen. (»Du Idiot! « hatte sein Vater geschrien, als er es erfahren hatte. »So was heiratet man doch nicht! « Und etwas in Abe Kinds Augen hatte dabei ein Schuldbewußtsein verraten, das seit Jahren unterdrückt gewesen war.) Den ganzen Abend lang hatten Dorothy und Leslie über Kochrezepte geredet. Als man sich schließlich zum Abschied küßte, hatte Dorothy trockene Augen und schien zerstreut. Abe weinte.
Am nächsten Morgen fuhren sie nach Hartford.
In der Hastings Congregational Church saßen sie in der Düsternis eines Korridors auf einer alten Holzbank und warteten, bis Reverend Mr.
Rawlings mit einem jungen Mann und einer jungen Frau aus seinem Büro kam.
»Hochzeiten in aller Stille sind immer am besten«, sagte er zu den beiden, sich von ihnen verabschiedend. »Die herzlichste und die würdigste Art, zu heiraten.«
Dann erblickte er das wartende Paar und sagte, ohne den Tonfall zu verändern: »Ah, Leslie.«
Michael und Leslie erhoben sich. Sie stellte ihn vor. »Wollt ihr nicht Tee trinken?«
Er führte sie in sein Büro, und da saßen sie, tranken Tee und aßen Keks, die von einer nicht mehr jungen, undurchdringlich dreinsehenden Frau aufgetragen wurden, und machten mühsam Konversation.
»Erinnerst du dich noch an die Gewürzkeks, die Tante Sally immer gebacken hat?« fragte Leslie ihren Vater, nachdem die Frau das Teegeschirr wieder hinausgetragen hatte. »Manchmal, wenn ich an die Tante zurückdenke, spüre ich den Geschmack direkt noch auf der Zunge.«
»Gewürzkeks?« sagte er, und, zu Michael gewandt: »Sally war meine Schwägerin. Eine brave Frau. Vor zwei Jahren ist sie gestorben. «
»Ich weiß«, sagte Michael.
»Sie hat Leslie tausend Dollar hinterlassen. Hast du das Geld noch, Leslie?«
»Ja«, sagte Leslie, »gewiß.«
Der Pfarrer trug eine randlose Brille; die sehr hellen Augen dahinter beobachteten Michael unablässig.
»Glauben Sie, daß Sie sich im Süden wohl fühlen werden?«
»Ich habe ein paar Jahre in Florida und in Arkansas gelebt«, sagte Michael. »Soweit ich sehen kann, sind Menschen überall Menschen.«
»Wenn man älter wird, merkt man doch einige wesentliche Unterschiede.«
Sie schwiegen. »Ich glaube, wir müssen jetzt gehen«, sagte Leslie und küßte ihren Vater auf die weiche rosige Wange. »Gib acht auf dich, Vater.«
»Das wird der Herr tun«, sagte er, sie zur Tür begleitend. »Ich bin in Seiner Hut.«
»Auch wir«, sagte Michael, aber sein Schwiegervater schien es nicht gehört zu haben.
Zwei Tage später kamen Leslie und Michael in Cypress, Georgia, an.
Es war ein heißer Nachmittag im Frühsommer, der ihnen einen Vorgeschmack von den sommerlichen Temperaturen in dieser Stadt gab. Das bronzene Reiterstandbild des Generals Thomas Mott Lainbridge auf dem Hauptplatz warf die Hitze in sichtbaren Wellen zurück. Michael brachte den Wagen am Rand des grasbewachsenen Rondeaus zum Stillstand, in dessen Mitte sich das Denkmal erhob, und sie warfen einen Blick darauf, von der Sonne geblendet. Sie konnten nur den Namen entziffern.
Читать дальше
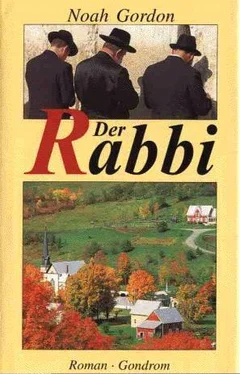
![Ной Гордон - Лекарь. Ученик Авиценны [litres]](/books/24255/noj-gordon-lekar-uchenik-avicenny-litres-thumb.webp)