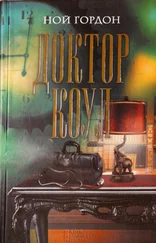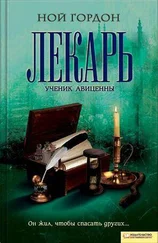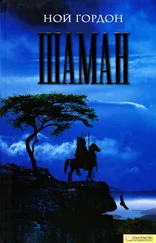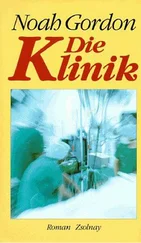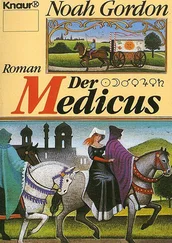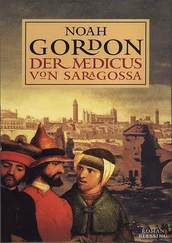Er verspürte auch keine Lust, seine Eltern jetzt schon einzuweihen, denn er wußte, daß er damit eine Szene heraufbeschwor, und das schob er gerne hinaus.
Er war eben bei seiner zweiten Tasse Kaffee angelangt, da läutete das Telephon.
Rabbi Sher war am Apparat.
»Woher wissen Sie, daß ich in New York bin?« fragte Michael nach dem Austausch der üblichen Höflichkeitsphrasen.
»Ich habe zufällig mit Milt Greenfield gesprochen«, sagte Rabbi Sher.
Das ist ganz Milt, dachte Michael.
»Können Sie auf einen Sprung bei mir im Büro vorbeikommen?«
fragte Rabbi Sher.
»Ja, heute nachmittag.«
»Es besteht für mich kein Zweifel, daß Sie Ihren Entschluß reiflich erwogen haben«, sagte Rabbi Sher betont liebenswürdig. »Ich möchte nur sichergehen, daß Sie sich auch aller möglichen Folgen einer solchen Verbindung bewußt sind.«
»Ich heirate eine Jüdin.«
»Möglicherweise ruinieren Sie sich eine brillante Rabbinatskarriere.
Solange Sie das wissen, ist alles in Ordnung, wenn auch vielleicht ...
nicht sehr realistisch. Ich wollte nur sichergehen, daß Sie nicht vielleicht die Folgen übersehen haben in einer Anwandlung von -« er suchte nach Worten.
»Sinnloser Leidenschaft.«
Rabbi Sher nickte. »Genau das.«
»Ist es nicht so, daß wir zeit unseres Lebens angesichts der weltlichen Verirrungen drauf bestehen, daß auch Juden nur Menschen sind, und daß alle Menschen gleich sind vor Gott. Wenn wir mit unseren Kindern über die Protokolle der Weisen von Zion reden, betonen wir ausdrücklich, daß wir einzig dazu auserwählt sind, die Bürde des Bundes zu tragen. Aber tiefer unter all dem liegt jene Angst, die uns zum vorurteilsbeladensten Volk der Erde gemacht hat. Warum ist das so, Rabbi?«
Von draußen drangen ferne Hupgeräusche an ihr Ohr. Rabbi Sher trat ans Fenster und sah auf das Verkehrschaos der Fifth Avenue hinunter. Nichts als Taxis. Viel zu viele. Außer es regnet und du brauchst eines, dachte er. Er wandte sich um. »Wie sonst hätten wir fünftausend Jahre überdauert?«
»Aber das Mädchen, das ich heirate, ist Jüdin.«
»Ihr Vater ist kein Jude.«
»Aber ist Judentum eine Frage des Blutes? Oder ist es ein ethischer, ein theologischer Begriff, eine Art zu leben?«
Rabbi Sher kniff die Augen zusammen. »Bitte, Michael, keine Diskussion! So einzigartig ist Ihre Situation auch wieder nicht, das wissen Sie. Wir haben so etwas schon gehabt, und es hat immer eine Menge Schwierigkeiten damit gegeben.« Er trat vom Fenster zurück.
»Sie sind also fest entschlossen?«
Michael nickte.
»Dann wünsche ich Ihnen viel Glück.« Er streckte Michael die Hand entgegen, und dieser schüttelte sie.
»Noch etwas, Rabbi«, sagte er. »Sie sollten jetzt jemand anderen für die Ozarks suchen.«
Sher nickte. »So jung verheiratet, werden Sie nicht dauernd unterwegs sein wollen.« Er legte die Finger zusammen. »Damit ergibt sich die Frage Ihrer weiteren Verwendung. Vielleicht hätten Sie Interesse an einer akademischen Laufbahn? Bei einer der Stiftungen für kulturelle Belange? Wir bekommen viele derartige Anfragen.«
Nach einer Pause setzte er hinzu: »Auf akademischem Boden ist man doch weniger engstirnig.«
»Ich will eine Gemeinde haben.« Michael wich dem Blick des anderen nicht aus.
Rabbi Sher seufzte. »Ein Gemeindeausschuß besteht aus Eltern. Wie immer Sie selbst über Ihre Heirat denken mögen - Eltern werden darin fast unvermeidlich ein schlechtes Beispiel für ihre Kinder sehen.«
»Ich will eine Gemeinde haben.«
Der Ältere hob hilflos die Schultern. »Ich werde mein möglichstes tun, Michael. Kommen Sie doch mit Ihrer Frau vorbei, wenn Sie ein bißchen Zeit haben. Ich möchte sie gern kennenlernen.« Und sie schüttelten einander nochmals die Hände.
Nachdem Michael gegangen war, ließ sich Rabbi Sher in seinen Sessel fallen, blieb eine Weile reglos sitzen und summte geistesabwesend die Toreador-Melodie aus »Carmen« vor sich hin. Dann drückte er den Summer auf seinem Schreibtisch.
»Lillian«, sagte er zu der eintretenden Sekretärin, »Rabbi Kind wird nicht mehr in die Ozarks gehen.«
»Soll ich die Karte in den Ordner Offene Stellen geben?« fragte sie.
Sie war eine verblühende Frau in mittleren Jahren, und sie tat ihm immer wieder leid.
»Bitte, tun Sie das«, sagte er. Nachdem sie gegangen war, summte er weiter den Bizet vor sich hin, alles, was ihm von den Melodien aus
»Carmen« noch irgend einfiel - dann drückte er nochmals den Summer.
»Halten Sie die Ozarks-Karte noch eine Weile zurück«, sagte er zu Lillian. »Vielleicht werden wir diesen Posten überhaupt nicht besetzen können, wenn wir nicht einen verheirateten Mann finden, der bereit ist, zu reisen.«
Ihr schneller Blick fragte, ob er nun endlich wisse, was er wolle. »Das ist aber sehr unwahrscheinlich«, sagte sie.
»Allerdings«, stimmte er zu.
Er trat ans Fenster, stützte die Hände auf die Brüstung und sah hinunter. Unten tobte der Fifth-Avenue-Verkehr wie eine Schlacht, die Hupen schrillten wie die Schreie von Verwundeten. Diese Taxis, dachte er, ruinieren die ganze Stadt.
25
Noch vor gar nicht so langer Zeit hatte es in Cypress, Georgia, keine jüdische Gemeinde gegeben. Vor dem Krieg-dem Zweiten Weltkrieg, nicht dem Bürgerkrieg - lebten in der ganzen Stadt kaum ein paar Dutzend jüdischer Familien. Ihr Oberhaupt war Dave Schoenfeld, Verleger und Herausgeber der wöchentlich erscheinenden Cypress News. Als Ururenkel des Captain Judah Schoenfeld, der unter Hood bei Peachtree Creek eine Kompanie kommandiert und dabei eine Miniékugel in den Hals bekommen hatte, war Dave mehr Südstaatler als Jude und unterschied sich kaum von irgendeinem starrköpfigen Baptisten in Cypress, höchstens dadurch, daß er einen etwas größeren Einfluß bei den Wahlen besaß.
Dave Schoenfeld befand sich als Oberstleutnant der Abwehr in Sondrestrom auf Grönland, als daheim in Cypress der erste Freitagabend-Gottesdienst gehalten wurde. Ein Militärrabbiner aus Camp Gordon, Jacobs mit Namen, brachte einen Bus voll jüdischer Infanteristen in die Stadt und zelebrierte in der First Baptist Church mit besonderer Erlaubnis der Diakone eine Jom-Kipur- Feier. Sie wurde von sämtlichen Juden der Stadt besucht und fand solchen Anklang, daß sie im darauffolgenden Jahr wiederholt wurde. Aber ein weiteres Jahr später war zu Jom-Kipur kein Rabbiner da, der den Gottesdienst hätte halten können, denn Rabbi Jacobs war nach Übersee versetzt worden und ein Ersatzmann für ihn noch nicht eingetroffen. Die hohen Feiertage kamen und gingen in Cypress ohne Gottesdienst, und dieser Mangel wurde in der Stadt bemerkt und kommentiert.
»Warum können wir nicht unseren eigenen Sabbat-Gottesdienst haben?«
regte der junge Dick Kramer an; er hatte Krebs und dachte viel über Gott nach.
Andere zeigten sich diesem Vorschlag zugänglich, und so kamen am folgenden Freitag vierzehn Juden im Hinterzimmer von Ronnie Levitts Haus zusammen. Sie rekonstruierten den Gottesdienst aus dem Gedächtnis, und Ronnie, der nach dem Ersten Weltkrieg in New York Gesang studiert hatte, bevor er nach Hause kam, um seines Vaters Terpentinfabrik zu leiten - Ronnie übernahm das Amt des Kantors. Sie sangen, was ihnen vom Ritual in Erinnerung geblieben war, begeistert und lautstark, wenn auch nicht durchaus melodisch. In der Küche im Oberstock sagte Rosella Barker, Sally Levitts Dienstmädchen, mit verklärtem Blick und breitem Grinsen zu ihrem vierzehnjährigen Bruder Mervin, der am Küchentisch Kaffee trank und darauf wartete, seine Schwester nach Hause zu begleiten:
»Diesen Leuten ist der Rhythmus angeboren, Honey. Weiße, gewiß -
aber sie haben Musik in sich, und die kommt heraus in allem, was sie tun
Читать дальше
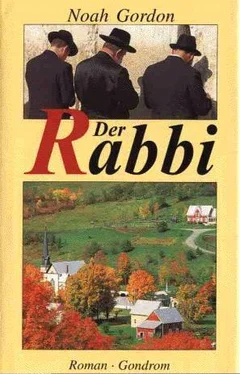
![Ной Гордон - Лекарь. Ученик Авиценны [litres]](/books/24255/noj-gordon-lekar-uchenik-avicenny-litres-thumb.webp)