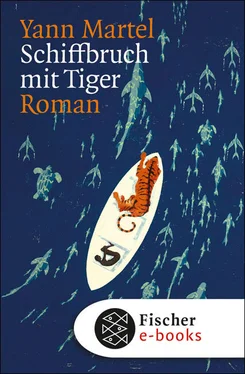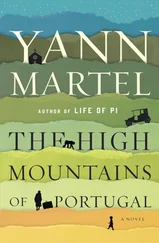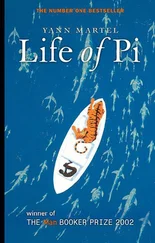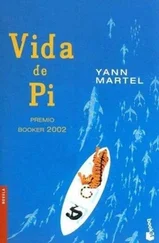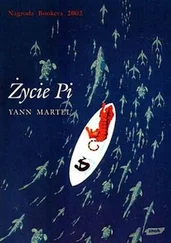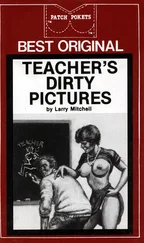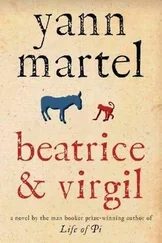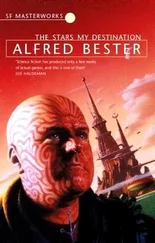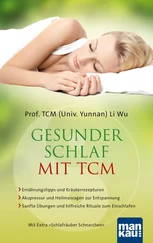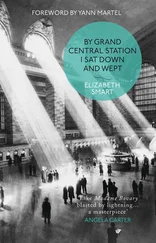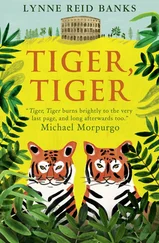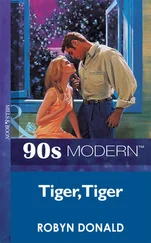Aber der Dompteur sollte gut aufpassen, dass er auch immer das Super-Alphatier bleibt. Wehe ihm, wenn er ohne es zu merken auf den Betaplatz rutscht. Ein Großteil der Feindseligkeit und des aggressiven Verhaltens bei Tieren ist Ausdruck einer sozialen Unsicherheit. Das Tier, das vor Ihnen steht, will wissen, woran es ist - ob es über- oder ob es unterlegen ist. Das ganze Leben eines Tiers dreht sich um Rangstrukturen; der Rang entscheidet, wo und wann es fressen kann, wo es ruhen kann, wo es trinken kann und so weiter. Solange es seinen Rangplatz nicht kennt, lebt ein Tier in unerträglicher Anarchie. Es bleibt nervös, reizbar, gefährlich. Der Dompteur im Zirkus nutzt den Umstand, dass bei den höheren Tieren der Rangplatz nicht unbedingt durch brutale Gewalt bestimmt wird. Hediger (1950) schreibt: »Wenn zwei Geschöpfe sich begegnen, wird derjenige, dem es gelingt, den anderen einzuschüchtern, als der Ranghöhere anerkannt, und zu einer solchen Rangentscheidung ist nicht immer ein Kampf erforderlich; in manchen Fällen genügt die bloße Begegnung.« Worte eines weisen Tierkenners. Hediger war viele Jahre lang Zooleiter, zuerst in Basel, dann in Zürich. Er war ein Mann, der wusste, wie Tiere miteinander umgehen.
Mit Verstandeskraft lässt sich Körperkraft übertrumpfen. Den Aufstieg zum höchsten Rang verdankt der Dompteur der Psychologie. Die unnatürliche Umgebung, die aufrechte Haltung des Dompteurs, seine Ruhe, sein fester Blick, die Art, wie er furchtlos voranschreitet, sein seltsames Brüllen (denn so werden Peitschenknall und Trillerpfeife empfunden) - all das verwirrt und verunsichert die Löwen, aber es schafft klare Verhältnisse, und darauf kommt es ihnen ja in erster Linie an. Zufrieden überlässt die Nummer zwei der Nummer eins die Führung, und Nummer eins kann ins Publikum brüllen: »Und jetzt die Sensation, meine Damen und Herren, der Sprung durch den Feuerreifen ...«
Kapitel 14
Interessant ist, dass der Löwe, der am willigsten bei den Kunststücken des Dompteurs mitmacht, der Rangniederste im Rudel ist, das Omegatier. Er hat bei einem guten Verhältnis zum Super-Alpha-Dompteur am meisten zu gewinnen. Und es geht um mehr als die kleinen Happen zur Belohnung. Eine gute Beziehung zum Anführer schützt ihn vor den Angriffen der anderen. Dieses besonders willige Tier, das für die Zuschauer genauso »wild« aussieht wie die anderen, ist der Star der Show, und die streitlustigeren Betaund Gammalöwen lässt der Dompteur als Statisten auf ihren bunten Fässern sitzen.
Dasselbe Verhalten kann man auch bei anderen Zirkustieren und im Zoo beobachten. Die sozial unterlegenen Tiere sind immer die, die sich am eifrigsten um ein gutes Verhältnis zum Wärter bemühen. Sie sind besonders treu, suchen besonders seine Gesellschaft, leisten am wenigsten Widerstand. Man hat es bei Großkatzen beobachtet, bei Bisons, bei Hirschen, bei Wildschafen, Affen und bei vielen anderen Tieren. Jeder, der sich in Zoos auskennt, kann Geschichten davon erzählen.
Kapitel 15
Sein Haus ist ein Tempel. Auf dem Flur hängt ein gerahmtes Bild Ganeshas, des Gottes mit dem Elefantenkopf. Rosig sieht er einen an, schmerbäuchig, eine Krone auf dem Kopf, ein Lächeln auf den Lippen; drei Hände halten Gegenstände, die vierte ist, die Handfläche nach außen, zum Segen oder zum Gruß erhoben. Er ist der Gott des Glücks, der, der alle Hindernisse überwindet, der Gott der Weisheit, der Gott der Gelehrsamkeit. Sehr simpatico. Ich muss ihn nur ansehen, schon bin ich gut gelaunt. Zu seinen Füßen wartet eine Ratte. Sein Reittier. Denn wenn der Gott Ganesha auf Reisen geht, dann reitet er auf einer Ratte. An der Wand gegenüber hängt ein schmuckloses hölzernes Kreuz.
Im Wohnzimmer steht auf einem Tischchen neben dem Sofa ein Bild der Muttergottes von Guadalupe, Blumen quellen aus ihrem offenen Umhang. Daneben, ebenfalls eine gerahmte Fotografie, die schwarz verhüllte Kaaba, das Allerheiligste des Islam, umgeben von der zehntausendfachen Schar der Gläubigen. Auf dem Fernseher steht eine Messingstatue, Shiva in Gestalt Natarajas, des Herrn des Tanzes, der die Bewegungen des Universums und den Fluss der Zeit beherrscht. Er tanzt auf dem Dämon der Dummheit, die vier Arme ausdrucksvoll ausgestreckt, ein Fuß auf dem Rücken des Dämons, einer in der Luft. Wenn Nataraja mit diesem Fuß auftritt, heißt es, wird die Zeit innehalten.
In der Küche ist ein Schrein. Er hat ihn in einem Schrank eingerichtet, dessen Tür durch einen handgesägten Bogen ersetzt ist. Halb verborgen hängt dahinter eine gelbe Glühbirne und erleuchtet nachts das Heiligtum. Hinter dem kleinen Altar stehen zwei Bilder: seitlich noch einmal Ganesha, in der Mitte in einem größeren Rahmen, lächelnd und blauhäutig, Krishna als Flötenspieler. Beide haben, auf dem Glas des Bilderrahmens, rote und gelbe Puderflecken auf der Stirn. In einer Kupferschale auf dem Altar drei silberne Murtis, Götterfiguren. Er weist mit dem Finger darauf und erklärt mir, wer es ist. Lakshmi; Shakti, die Muttergöttin, in Gestalt der Parvati; und Krishna, diesmal als wonnig krabbelndes Baby. Zwischen den beiden Göttinnen liegt ein steinernes Shiva yoni linga, das aussieht wie eine Avocado, aus deren Mitte sich ein stämmiger Phallus erhebt, ein Hindusymbol, das die männlichen und weiblichen Energien des Kosmos verkörpert. Auf der einen Seite der Schale steht auf einem Sockel ein kleines Schneckenhaus, auf der anderen ein silbernes Glöckchen. Überall liegen Reiskörner, dazu eine Blume, die eben zu welken beginnt. Viele Stücke tragen die gelben und roten Flecken.
Auf dem Regalbrett darunter finden sich rituelle Gerätschaften: ein Krug mit Wasser, ein Kupferlöffel, eine Öllampe mit gewundenem Docht, Räucherstäbchen sowie Schälchen mit rotem und gelbem Puder, Reiskörnern und Zuckerwürfeln.
Im Esszimmer hängt ein weiteres Marienbild.
Oben im Arbeitszimmer sitzt gleich neben dem Computer ein Ganesha aus Messing mit gekreuzten Beinen, an der Wand hängt ein hölzernes Kruzifix aus Brasilien, und in der Ecke liegt ein grüner Gebetsteppich. Das Kruzifix ist eine sehr expressive Darstellung des Schmerzensmanns. Der Teppich hat einen Teil des Raumes für sich. Daneben auf einem niedrigen Bücherständer ein Band, mit einem Tuch abgedeckt. In der Mitte des Tuches steht, kunstvoll eingewoben, ein einzelnes arabisches Wort, vier Buchstaben: ein alif, zwei lams und ein ha. Der Name Gottes.
Auf dem Nachttisch eine Bibel.
Kapitel 16
Werden wir nicht alle geboren wie Katholiken - unwissend und ungläubig, bis jemand uns mit Gott bekannt macht? Und ist das geschehen, ist für die meisten von uns die Sache auch schon erledigt. Verändert sich etwas, ist es eher ein Verlust als ein Zugewinn; vielen Menschen geht anscheinend Gott im Laufe ihres Lebens verloren. Doch anders bei mir. Mein erstes religiöses Erlebnis verdanke ich einer älteren, traditionsbewussteren Schwester meiner Mutter, die mich fast noch als Neugeborenes mit in einen Tempel nahm. Tante Rohini war so begeistert, als sie ihren kleinen Neffen sah, da wollte sie die Muttergöttin an ihrer Freude teilhaben lassen. »Es wird ein symbolischer erster Ausflug«, sagte sie. »Ein Samskara!« Symbolisch war es. Es geschah in Madurai, ich hatte gerade erst eine siebenstündige Zugfahrt überstanden. Aber das spielte keine Rolle. Auf der Stelle brachen wir zu diesem hinduistischen Initiationsritus auf; Mutter trug mich im Arm, die Tante trieb sie voran. Eine bewusste Erinnerung an diesen ersten Tempelbesuch ist mir nicht geblieben, aber ein Weihrauchduft, ein Spiel von Licht und Schatten, eine Flamme, ein Farbfleck, etwas von der geheimnisvollen Würde des Ortes muss mich beeindruckt haben. Der Keim religiöser Begeisterung, nicht größer als ein Senfkorn, war gesät und ging in mir auf. Und bis zum heutigen Tag hat die Frucht nie aufgehört zu wachsen.
Читать дальше