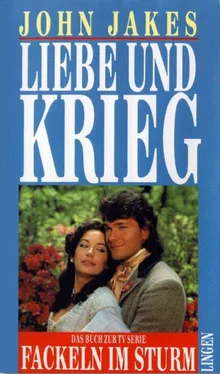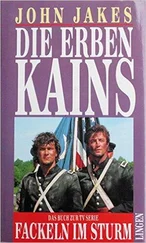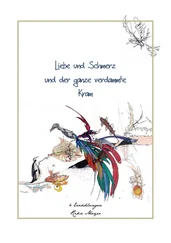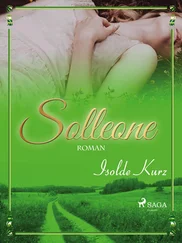Die Jahre in Felicity waren die dunkelsten in Bents gesamtem Leben, nicht nur, weil er seine Stiefeltern haßte, sondern auch, weil er mit fünfzehn Jahren erfuhr, daß sein richtiger Vater in Washington lebte und ihn nicht anerkannte. Zuvor hatte er angenommen, sein Vater sei ein verstorbener Verwandter der Bents, der Schande über die Familie gebracht hatte; wann immer der Junge Fragen stellte, hatte er nur ausweichende Antworten erhalten.
Dills war es gewesen, der die lange Fahrt mit Kutsche und Schiff auf sich genommen hatte, um sich von Bents Wohlergehen zu überzeugen und ihm die Wahrheit zu sagen. Dills Ausführungen über Starkwether waren weitschweifig, die Sätze taktvoll, sogar sanft, aber er hatte keine Ahnung, wie tief er seinen Zuhörer verletzte. Seitdem schwang in Bents Liebe zu seinem Vater stets unterdrückte Wut und Gewalttätigkeit mit, ganz gleich, wie sehr ihn dieser mit Einfluß oder Geld unterstützte.
Bent war sechzehn – kurze Zeit später stellte Starkwether die Zulassung des Jungen zur Militärakademie sicher –, als Fulmer Bent Schweine zum Markt nach Cincinnati brachte und dort bei einer Schießerei in einem Haus mit üblem Ruf starb. Im gleichen Herbst weckte eine junge Angestellte vom Krämerladen in Felicity Bents sexuelle Begierde, aber erst zwei Jahre später hatte Bent seine erste Frau.
Lange bevor Starkwether jedoch die Akademie-Zulassung durchsetzte, hatte Elkanah Bent schon von einer Militärkarriere zu träumen begonnen. Der Traum nahm seinen Anfang in einem unordentlichen Buchladen in Cincinnati, in den der Junge eines Tages spazierte, während Fulmer Bent anderswo seinen Geschäften nachging. Für fünf Cent kaufte er ein zerfleddertes, wasserfleckiges Buch über Bonapartes Leben. Das war der Beginn.
Er sparte sich etwas von dem Taschengeld ab, das Dills ihm zweimal jährlich schickte. Er kaufte und las mehrmals die Biographien von Alexander, Caesar, Scipio Africanus. Aber es war Napoleon, zu dessen Erbe und amerikanischem Gegenstück er in seiner lebhaften Phantasie wurde.
Der Bonaparte von Kentucky? Mit größerer Wahrscheinlichkeit würde er als Leiche enden. Der Staat war umstrittenes Gebiet; die eine Hälfte der Männer hatte sich auf Seiten der Union, die andere auf Seiten der Konföderation geschlagen. Lincoln ließ die Finger von den Sklavenbesitzern, damit sie nicht die Sezession unterstützten. Niemals würde er an einen solchen Ort gehen.
Der Schweiß lief ihm über die Wangen, als er dem Kellner winkte. »Bringen Sie mir noch ein Stück Kuchen.« Er stopfte es in sich hinein und lehnte sich zurück. Ein drittes Stück führte ihn in Versuchung, aber sein Magen schmerzte, und so konzentrierte er sich auf sein Problem. Er glaubte immer noch an eine große militärische Zukunft für sich; allerdings durfte er in dem Fall nicht in Kentucky sterben.
Er wußte, daß jetzt nur noch ein Mann intervenieren konnte. Bent war davor gewarnt worden, mit ihm persönlichen Kontakt aufzunehmen, aber eine verzweifelte Lage rechtfertigte verzweifelte Maßnahmen.
Das Büro von Jasper Dills, Esquire, ging zur Seventh Street hinaus, dem Handelszentrum der Stadt. Der mit Büchern vollgestopfte Raum war klein und eng und deutete auf eine mißratene Kanzlei hin; kein Hinweis auf Reichtum und Status seines Inhabers.
Nervös senkte Bent sein Hinterteil in den Besucherstuhl, zu dem ihn der Angestellte geführt hatte. Er mußte sich reinquetschen, so eng war der Sitz. Er hatte seine Ausgehuniform angezogen, aber Dills Gesichtsausdruck besagte deutlich, daß die Mühe umsonst gewesen war.
»Ich dachte, Sie hätten begriffen, daß Sie hier nicht zu erscheinen haben, Colonel.«
»Es handelt sich um außergewöhnliche Umstände.«
Dills hob eine Augenbraue, was seinen verstörten Besucher beinahe völlig aus dem Gleichgewicht gebracht hätte.
»Ich brauche dringend Ihre Hilfe.«
Dills hielt seinen Schreibtisch sauber. In der Mitte lagen einige Notizblätter. Er tauchte eine Feder ein und begann, Sterne zu malen.
»Sie wissen doch, Ihr Vater kann Ihnen nicht mehr helfen.« Die Feder kratzte; ein weiterer Stern erschien. »Ich habe gesehen, wie Sie sich gestern auf dem Friedhof herumdrückten – Sie brauchen es gar nicht abzustreiten. Der Fehltritt ist verzeihlich.« Kratz; kratz. Mit den Sternen fertig, malte der Anwalt ein großes B. Dann warf er seinem Besucher einen scharfen Blick zu. »Dieser hier nicht.«
Bent wurde rot, gleichzeitig vor Furcht und vor Ärger. Wie konnte ihn dieser Mann derart einschüchtern? Jasper Dills war über siebzig und keine eins sechzig groß. Er hatte die Hände und Füße von einem Kind. Doch weder Größe noch Alter minderten die Kraft seiner Stimme oder die einschüchternde Art und Weise, in der er einen Mann anblicken konnte.
»Ich bitte – «, er schluckte, »– ich bitte zu unterscheiden, Sir. Ich bin verzweifelt.« In ein paar herausgesprudelten Sätzen beschrieb er seine Situation. Dills malte weiter und ließ ihn am Ende seines Vortrags schweigend zehn Sekunden zappeln. »Aber ich begreife immer noch nicht, weshalb Sie zu mir gekommen sind. Ich besitze weder die Macht noch einen Grund, Ihnen zu helfen. Meine einzige Verpflichtung als Testamentsvollstrecker Ihres Vaters besteht darin, seinen mündlichen Instruktionen Folge zu leisten und dafür zu sorgen, daß Sie weiterhin Ihre großzügig bemessene jährliche Geldzuwendung erhalten.«
»Das verdammte Geld bedeutet mir gar nichts, wenn ich nach Kentucky geschleppt werde, um dort zu sterben!«
»Aber was kann ich dagegen tun?«
»Lassen Sie meinen Marschbefehl ändern. Sie haben es früher schon getan – Sie oder mein Vater. Oder taten das jene Männer, die ihn beschäftigten?« Das hatte gesessen; Dills versteifte sich sichtbar. Hier ließ sich der entscheidende Bluff ansetzen. »Oh ja, ich weiß einiges über sie. Ich hab’ ein paar Namen gehört. Ich habe meinen Vater zweimal gesehen, vergessen Sie das nicht. Jedesmal einige Stunden. Ich hab’ Namen gehört«, wiederholte er.
»Colonel, Sie lügen.«
»Wirklich? Testen Sie mich doch. Verweigern Sie mir Ihre Hilfe. Ich werde mich sehr schnell mit gewissen Leuten unterhalten, die an den Namen der Auftraggeber meines Vaters interessiert sind. Oder meiner wahren Herkunft.«
Schweigen. Bent atmete laut. Er hatte gewonnen, davon war er überzeugt.
Dills seufzte. »Colonel Bent, Sie haben einen Fehler gemacht. Zwei, um genau zu sein. Ihr erster Fehler war, wie ich bereits erwähnte, Ihr Entschluß, mich aufzusuchen. Ihr zweiter ist Ihr Ultimatum.« Er legte seine Feder auf die hingekritzelten Sterne. »Ich möchte nicht melodramatisch werden, ich möchte lediglich einen Punkt so klar wie möglich machen. In dem Augenblick, in dem ich erfahre, daß Sie irgendeinen Versuch unternommen haben, Ihre Beziehung zu meinem verstorbenen Klienten an die Öffentlichkeit zu bringen, oder irgend etwas tun, was seinem Ruf schaden könnte, von dem Augenblick an sind Sie innerhalb von vierundzwanzig Stunden ein toter Mann.« Dills lächelte. »Guten Tag, Sir.«
Er erhob sich und ging zu seinen Bücherregalen. Bent schoß aus seinem Stuhl hoch, um den Schreibtisch herum. »Verdammt noch mal, wie können Sie es wagen, so mit Starkwethers eigenem – «
Dills wirbelte herum, schlug ein Buch mit einem Laut wie ein Gewehrschuß zusammen. »Ich sagte: guten Tag.«
Während Bent die lange Treppe zur Straße hinabstolperte, kreischte eine innere Stimme: Er meint es ernst. Der Mann meint es ernst. Was soll ich nun tun?
In seinem Büro stellte Dills das Buch wieder an seinen Platz und kehrte zum Schreibtisch zurück. Er bemerkte, daß seine gefleckten Hände zitterten. Die Reaktion ärgerte und beschämte ihn. Außerdem war sie unnötig.
Ganz sicher wünschten die Auftraggeber seines früheren Klienten, daß ihre Namen im dunkeln blieben. Doch Dills vertraute darauf, daß Bent ihre Identität nicht kannte. Abgesehen davon war Bent eindeutig ein Feigling und deshalb leicht einzuschüchtern. Natürlich konnte Dills über Starkwethers Verbindungen leicht dafür sorgen, daß Bent eine tödliche Kugel traf. In Kentucky ließ sich das sogar so arrangieren, daß es sich bei dem Killer scheinbar um einen Rebellen handelte. Aber solch ein Plan würde für den Anwalt lediglich finanzielle Nachteile mit sich bringen, was wiederum Bent nicht wußte.
Читать дальше