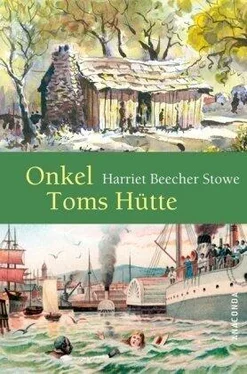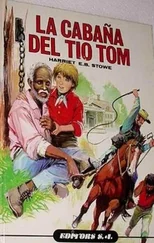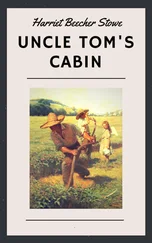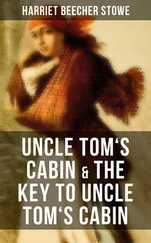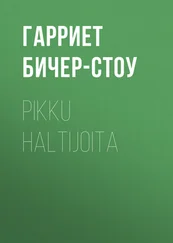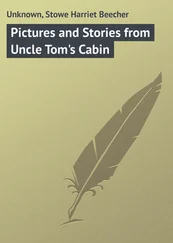»Sind sie viel Geld wert, Mama?«
»Aber gewiß. Sie kosteten ein kleines Vermögen.«
»Ich wollte, ich hätte sie schon«, sagte Eva, »dann machte ich damit, was ich wollte.«
»Was würdest du denn mit ihnen anfangen?«
»Ich würde sie verkaufen und in den freien Staaten ein Gut erwerben, alle unsere Leute dorthin bringen und Lehrer anstellen, damit sie schreiben und lesen lernen.«
Eva wurde durch das Gelächter ihrer Mutter unterbrochen.
»Eine Volksschule einrichten! Willst du ihnen nicht auch Klavierspielen und Samtmalerei beibringen?«
»Nein«, sagte Eva ungerührt. »Ich will, daß sie lernen, die Bibel zu lesen und ihre Briefe zu schreiben und auch die Briefe, die sie bekommen, zu lesen. Ich weiß, Mama, wie arg es ihnen ist, daß sie dies alles nicht können. Tom leidet darunter — Mammy auch — und noch viele andere. Das ist nicht richtig.«
»Komm, Eva, du bist nur ein Kind. Du verstehst diese Dinge nicht«, sagte Marie, »außerdem bekomme ich Kopfweh, wenn du soviel sprichst.«
Marie hatte immer ein Kopfweh zur Hand, sobald eine Unterhaltung nicht ganz nach ihrem Geschmack verlief. Eva stahl sich davon; aber von jetzt an gab sie Mammy unverdrossen Lesestunden.
Zu dieser Zeit kam St. Clares Bruder mit seinem ältesten Sohn auf ein, zwei Tage zu Besuch an den See. Beide Zwillingsbrüder boten einen ungewöhnlich schönen Anblick. Die Natur hatte anstatt einer Ähnlichkeit den Gegensatz zwischen beiden herausgearbeitet, jedoch waren beide durch ein geheimnisvolles Band in ungewöhnlich enger Freundschaft miteinander verbunden. Arm in Arm schlenderten sie zusammen durch den Garten — Augustin mit seinen blauen Augen, dem blonden Haar, den lebhaften Zügen und der biegsamen Gestalt und der dunkeläugige Alfred mit seinem stolzen römischen Profil, seinen stattlichen Gliedern und der entschlossenen Haltung. Sie hörten nicht auf, einander zu schmähen, und doch genossen sie ihr Zusammensein, ja ihre Gegensätzlichkeit schien sie wie die beiden Pole eines Magneten gegenseitig anzuziehen.
Henrique, Alfreds ältester Sohn, war ein vornehmer, dunkelhäutiger Knabe, aufgeweckt und lebhaft, schon nach der ersten Bekanntschaft war er von der vergeistigten Anmut seiner Kusine Evangeline hingerissen.
Eva hatte ein kleines, schneeweißes Lieblingspony, so sanft wie seine Herrin, und dieses Pony brachte jetzt Tom an die hintere Veranda, während ein Mulattenjunge von ungefähr dreizehn Jahren einen kleinen, schwarzen Araber heranführte, der erst vor kurzem für Henrique gekauft worden war.
Henrique war knabenhaft stolz auf diesen neuen Schatz; als er jetzt herantrat und dem kleinen Reitknecht die Zügel abnahm, musterte er das Pferd genau, und sein Gesicht verfinsterte sich.
»Was soll das heißen, Dodo, du Faulpelz, du hast mein Pferd heute morgen nicht abgerieben?«
»Doch, Herr«, sagte Dodo unterwürfig. »Er ist selber wieder staubig geworden.«
»Halt den Mund, du Spitzbube!« rief Henrique und hob heftig die Reitpeitsche. »Untersteh dich, noch ein Wort!«
Der Junge war ein hübscher, helläugiger Mulatte, genau von Hen–riques Größe, sein Haar ringelte sich um eine hohe, kühne Stirn. Er hatte >weißes< Blut in den Adern, was man an der jähen Röte seiner Wangen und dem Blitzen seiner Augen erkannte, als er eifrig anhub: »Junger Herr.«
Schon schlug ihn Henrique mit der Reitpeitsche über das Gesicht, ergriff ihn am Arm, zwang ihn auf die Knie und schlug ihn, bis er außer Atem war.
»Da hast du es, du unverschämter Hund! Wirst du jetzt den Mund halten, wenn ich rede? Führe das Pferd zurück, und reinige es, wie es sich gehört — ich werde dich lehren!«
»Junger Herr«, sagte Tom, »er wollte nur sagen, daß das Pferd sich auf dem Rücken gewälzt hat, als er es aus dem Stall brachte, es steckt voller Übermut — dabei ist es staubig geworden. Ich habe selbst das Reinigen beaufsichtigt.«
»Warte ab, bis du gefragt wirst«, sagte Henrique, drehte sich auf dem Absatz um und sprang Eva entgegen, die im Reitkleid an der Treppe stand.
»Liebstes Kusinchen, es tut mir leid, daß wir nun auf diesen Dummkopf warten müssen. Komm, wir setzen uns hier hin. Was ist denn los, Kusinchen? Du machst so ein merkwürdiges Gesicht.«
»Wie konntest du nur so grausam und böse zu Dodo sein?«
»Grausam — böse?« fragte der Knabe mit unverhohlener Überraschung. »Was meinst du denn, liebste Eva?«
»Ich will nicht, daß du mich >liebste Eva< nennst, wenn du so etwas tust«, sagte sie.
»Liebstes Kusinchen, du kennst den Dodo nicht, nur auf diese Weise wird man mit ihm fertig, er steckt voller Lügen und Ausflüchte. Man muß ihn sofort zum Schweigen bringen; so macht Papa das auch.«
»Aber Onkel Tom sagte, es war ein Versehen, und er sagt nie die Unwahrheit.«
»Dann ist er ein ungewöhnlicher alter Nigger!« sagte Henrique; »Dodo lügt, wenn er den Mund auftut.«
»Du zwingst ihn ja zum Lügen, wenn du ihn so behandelst, du hast ihn geschlagen, ohne daß er es verdiente.«
»Nun, das kann ich ihm ja fürs nächstemal anrechnen. Bei Dodo sind ein paar Schläge immer am Platze — er ist ein reiner Teufel, sage ich dir; aber ich werde ihn nicht wieder in deiner Gegenwart schlagen, wenn dir das Kummer macht.«
Eva war noch nicht zufrieden, aber sie gab es auf, ihrem hübschen Vetter ihre Empörung zu erklären.
Dodo kam alsbald mit den Pferden zurück.
»Na, Dodo, diesmal hast du deine Sache gut gemacht«, sagte sein junger Herr mit gnädiger Miene. »Komm her, halte Miß Evas Pferd, während ich sie in den Sattel hebe.«
Dodo trat heran und hielt Evas Pony. Er machte ein trauriges Gesicht.
Henrique, der stolz auf sein ritterliches Benehmen war, hatte seine schöne Kusine rasch in den Sattel gehoben und ihr die Zügel in die Hand gelegt.
Aber Eva beugte sich über die andere Seite ihres Pferdes, wo Dodo stand, und sagte, als er die Zügel freigab: »Du bist ein guter Junge, Dodo — ich danke dir!«
Staunend blickte Dodo empor in das süße junge Gesicht; das Blut stürzte ihm in die Wangen, die Tränen traten ihm in die Augen.
»Hierher, Dodo!« rief sein Herr gebieterisch.
»Hier ist ein Trinkgeld für Kandiszucker, Dodo«, sagte Henrique, »kauf dir welchen.«
Und Henrique trabte hinter Eva den Weg hinunter. Dodo stand und blickte den Kindern nach, eines hatte ihm Geld gegeben, das andere das, wonach er viel mehr verlangte, ein freundliches Wort in freundlichem Ton. Dodo war erst seit einigen Wochen von seiner Mutter getrennt. Sein Herr hatte ihn wegen seines hübschen Äußeren auf dem Sklavenmarkt gekauft, als passendes Gegenstück zu dem hübschen Pony; nun empfing er aus der Hand seines jungen Herrn seine erste Erziehung.
Vom Garten her hatten die beiden Brüder St. Clare die Prügelszene mitangesehen.
Augustin war die Röte ins Gesicht gestiegen, aber er bemerkte nur mit seiner gewohnten sarkastischen Leichtigkeit: »Ich vermute, das nennt man republikanische Erziehung, wie?«
»Henrique hat den Teufel im Leib, wenn er wütend wird«, sagte Alfred nachlässig.
»Anscheinend betrachtest du dies für ihn als sehr geeignete Übung?« sagte Augustin trocken.
»Ich kann da nicht viel ändern, Henrique ist ein Unband, seine Mutter und ich haben es längst mit ihm aufgegeben. Aber außerdem ist der Dodo ein kleines Biest — keine Prügel können ihn heilen.«
»Und dabei lernt Henrique das erste Gebot des republikanischen Katechismus, >Alle Menschen sind frei und gleich geboren<, wie?«
»Pah!« sagte Alfred. »Es ist einfach lächerlich, wie sich so ein Ausspruch bis auf unsere Tage erhält.«
»Ich kann dir sagen«, erklärte Augustin, »wenn sich etwas mit der Kraft eines göttlichen Gesetzes offenbart, dann ist es dieses, daß die Massen sich erheben und die unteren Klassen die Herrschaft erringen werden.«
Читать дальше