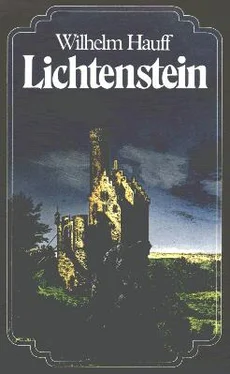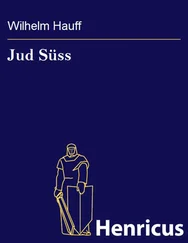So war nun ganz Württemberg bis herauf gegen Kirchheim in der Bündischen Gewalt, und der Bayern Herzog brach sein Lager auf, um mit Ernst an Stuttgart zu gehen. Da kamen ihm Gesandte entgegen nach Denkendorf, die um Gnade flehten. Sie durften zwar nicht wagen vor dem erbitterten Feind ihren Herzog zu entschuldigen, aber sie gaben zu bedenken, daß ja er , die Ursache des Krieges, nicht mehr unter ihnen sei, daß man nur gegen seinen unschuldigen Knaben, den Prinzen Christoph und gegen das Land Krieg führe. Aber vor der ehernen Stirne Wilhelms von Bayern, vor den habgierigen Blicken der Bundesglieder fanden diese Bitten keine Gnade. Ulerich habe diese Strafe verdient, gab man zur Antwort, das Land habe ihn unterstützt, also mit gefangen, mit gehangen – auch Stuttgart mußte seine Tore öffnen. [22] Dieser Verrat von Teck fand wirklich also statt. Vergl. z.B. Sattler II. §. 7.
Aber noch war der Sieg nichts weniger als vollständig; der größte Teil des Oberlandes hielt noch zu dem Herzog, und es schien nicht, als ob er sich auf den ersten Aufruf ergeben wollte. Dieses höher gelegene Gebirgsland wurde von zwei festen Plätzen, Urach und Tübingen, beherrscht, solange diese sich hielten, wollten auch die Lande umher nicht abfallen. In Urach hielt es die Bürgerschaft mit dem Bunde, die Besatzung mit dem Herzog. Es kam zum Handgemenge, worin der tapfere Kommandant erstochen wurde, die Stadt ergab sich den Bündischen.
Und so war in der Mitte des April nur Tübingen noch übrig; doch dieses hatte der Herzog stark befestigt; dort waren seine Kinder und die Schätze seines Hauses; dem Kern des Adels, vierzig wackeren, kampfgeübten Rittern und zweihundert der tapfersten Landeskindern war das Schloß anvertraut. Diese Feste war stark; mit Kriegsvorräten wohl versehen, an ihr hingen jetzt die Blicke der Württemberger; denn aus diesen Mauern war ihnen schon manches Schöne und Herrliche hervorgegangen, von diesen Mauern aus konnte das Land wieder dem angestammten Fürsten erobert werden, wenn es sich so lange hielt, bis er Entsatz herbeibrachte. Und dorthin wandten sich jetzt die Bündischen mit aller Macht. Ihrer Gewappneten Schritte tönten durch den Schönbuch, die Täler des Neckars zitterten unter dem Hufschlag ihrer Rosse; auf den Fildern zeigten tiefe Spuren, wohin die schweren Feldschlangen, Falkonen und Bombarden, die Kugel- und Pulverwagen, der ganze furchtbare Apparat einer langen Belagerung gezogen war.
Diese Fortschritte des Krieges hatte Georg von Sturmfeder nicht gesehen. Ein tiefer, aber süßer Schlummer hielt wie ein mächtiger Zauber seine Sinne viele Tage lang gefangen; es war ihm in diesem Zustand wohl zumut wie einem Kinde, das an dem Busen seiner Mutter schläft, nur hin und wieder die Augen ein wenig öffnet, um in eine Welt zu blicken, die es noch nicht kennt, um sie dann wieder auf lange zu verschließen. Schöne beruhigende Träume aus besseren Tagen gaukelten um sein Lager, ein mildes, seliges Lächeln zog oft über sein bleiches Gesicht und tröstete die, welche mit banger Erwartung seiner pflegten.
Wir wagen es, den Leser in die niedere Hütte zu führen, die ihn gastfreundlich aufgenommen hatte, und zwar am Morgen des neunten Tages, nachdem er verwundet wurde.
Die Morgensonne dieses Tages brach sich in farbigen Strahlen an den runden Scheiben eines kleinen Fensters, und erhellte das größere Gemach eines dürftigen Bauernhauses. Das Geräte, womit es ausgestattet war, zeugte zwar von Armut, aber von Reinlichkeit und Sinn für Ordnung. Ein großer eichener Tisch stand in einer Ecke des Zimmers, auf zwei Seiten von einer hölzernen Bank umgeben. Ein geschnitzter, mit hellen Farben bemalter Schrein mochte den Sonntagsstaat der Bewohner, oder schöne selbstgesponnene Leinwand enthalten; das dunkle Getäfer der Wände trug ringsum ein Brett, worauf blanke Kannen, Becher und Platten von Zinn, irdenes Geschirr mit sinnreichen Reimen bemalt, und allerlei musikalische Instrumente eines längst verflossenen Jahrhunderts, als Zimbeln, Schalmeien und eine Zither aufgestellt waren. Um den großen Kachelofen, der weit vorsprang, waren reinliche Linnen zum Trocknen aufgehängt, und sie verdeckten beinahe dem Auge eine große Bettstelle, mit Gardinen von großgeblümtem Gewebe, die im hintersten Teil der Stube aufgestellt war.
An diesem Bette saß ein schönes, liebliches Kind, von etwa sechzehn bis siebzehn Jahren. Sie war in jene malerische Bauerntracht gekleidet, die sich teilweise bis auf unsere Tage in Schwaben erhalten hat. Ihr gelbes Haar war unbedeckt, und fiel in zwei langen, mit bunten Bändern durchflochtenen Zöpfen über den Rücken hinab. Die Sonne hatte ihr freundliches, rundes Gesichtchen etwas gebräunt, doch nicht so sehr, daß es das schöne jugendliche Rot auf der Wange verdunkelt hätte; ein munteres, blaues Auge blickte unter den langen Wimpern hervor. Weiße faltenreiche Ärmel bedeckten bis an die Hand den schönen Arm, ein rotes Mieder mit silbernen Ketten geschnürt, mit blendend weißen, zierlich genähten Linnen umgeben, schloß eng um den Leib; ein kurzes, schwarzes Röckchen fiel kaum bis über die Knie herunter; diese schmucken Sachen und dazu noch eine blanke Schürze und schneeweiße Zwickelstrümpfe mit schönen Kniebändern, wollten beinahe zu stattlich aussehen zu dem dürftigen Gemach, besonders da es Werktag war.
Die Kleine spann emsig feine, glänzende Fäden aus ihrer Kunkel, zuweilen lüftete sie die Gardinen des Bettes und warf einen verstohlenen Blick hinein. Doch schnell, als wäre sie auf bösen Wegen erfunden worden, schlug sie die Vorhänge wieder zu und strich die Falten glatt, als sollte niemand merken, daß sie gelauscht habe.
Die Türe ging auf, und eine runde, ältliche Frau in derselben Tracht wie das Mädchen, aber ärmlicher gekleidet, trat ein. Sie trug eine dampfende Schüssel Suppe zum Frühstück auf und stellte Teller auf dem Tische zurecht. Indem fiel ihr Blick auf das schöne Kind am Bette, sie staunte sie an und wenig hätte gefehlt, so ließ sie den Krug mit gutem Apfelwein fallen, den sie eben in der Hand hielt.
»Was fällt der aber um Gottes willa ei', Bärbele«, sagte sie, indem sie den Krug niedersetzte und zu dem Mädchen trat, »was fällt der ei', daß de am Wertich da nuia rauta Rock zum Spinna anziehst? und au 's nui Mieder hot se an, und, ei daß di! – au a silberne Kette. Und en frischa Schurz und Strümpf no so mir nix dir nix aus em Kasta reißa? Wer wird denn en solcha Hochmuat treiba, du dumms Ding, du? Woißt du net, däß mer arme Leut sind? und daß du es Kind voma ouglückliche Mann bist? –« [A1] Wir setzen für Leser, welche dieses Idiom nicht verstehen, hier eine getreue Übersetzung bei: »Was fällt dir aber um Gottes willen ein, daß du am Werktag den neuen roten Roch zum Spinnen anziehst? Auch das neue Mieder hat sie an und eine silberne Kette. Und einen frischen Schurz und frische Strümpfe ungefragt aus dem Kasten reißen! wer wird solchen Hochmut treiben? Dummes Kind, weißt du nicht daß wir arme Leute sind, daß du die Tochter eines unglücklichen Mannes bist?«
Die Tochter hatte geduldig die ereiferte Frau ausreden lassen; sie schlug zwar die Augen nieder, aber ein schelmisches Lächeln, das über ihr Gesicht flog, zeigte, daß die Strafpredigt nicht sehr tief gehe. »Ei, so lasset uich doch b'richta«, antwortete sie, »was schadet's denn dem Rock, wenn i ihn au amol amma christliche Wertag ahan? an der silberna Kette wird au nix verderbt, und da Schurz kann i jo wieder wäscha!« [A2] »Lasset Euch doch berichten! was schadet es denn diesem Rock, wenn ich ihn einmal an einem christlichen Werktag anhabe; an der silbernen Kette wird auch nichts verdorben, und den Schurz kann man wieder waschen!«
»So? als wemma et immer gnuag z'wäscha und z'putza hätt? So sag mer no, was ist denn in de gfahra, daß de so strählst und schöa machst?« [A3] »So? als hätte man nicht genug zu waschen? Sag mir nur, was ist denn in dich gefahren, daß du dich so aufputzt und schön machst?«
Читать дальше