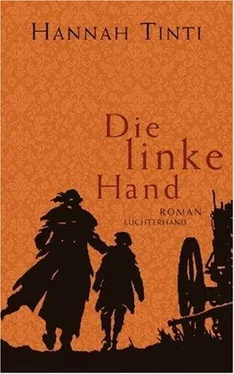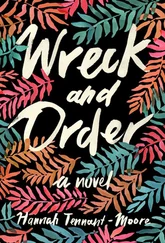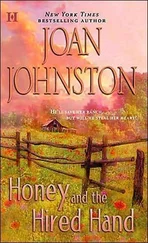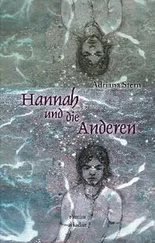»Dieser Mann ist nicht dein Freund. Er ist ein Mörder. Wenn es ihm in den Sinn kommt, bringt er uns womöglich noch alle um.« Als Ren protestieren wollte, hob Benjamin eine Hand. »Ich kenne diese Sorte. Männer, die überhaupt nichts mehr empfinden. Erst spendieren sie dir ein Bier, und im nächsten Augenblick schneiden sie ohne jeden Grund dem Schankkellner die Kehle durch oder schlitzen eine Frau neben dir auf oder sägen einem Mann die Hand ab.« Benjamin rieb sich die Nase, dann sah er Ren an, um sich zu vergewissern, dass dieser ihm zuhörte. Ren musste an den Mann mit den roten Handschuhen denken, der seine Suppe mit dem Löffel des Schankkellners gegessen hatte. »Sein einziger Wert besteht in dem, was er für uns tun kann. Ich habe versucht, dir beizubringen, was ich weiß«, sagte Benjamin. »Wann immer du dich an jemanden bindest, bringst du dich in Gefahr.«
Ren spürte die Hitze auf seinem Gesicht. Es war zu warm für ein Feuer. Er wusste, dass Mrs. Sands es missbilligt hätte, und befürchtete, der Schornstein könnte nicht so rechtzeitig abkühlen, dass sich der Zwerg sein Abendessen holen konnte. Bestimmt schwitzte Benjamin in seinem neuen Mantel, aber er blieb sitzen, obwohl seine Stirn feucht wurde, und wartete darauf, dass Ren sagte, was er hören wollte.
»Ich bin überhaupt nicht in Gefahr.«
»Gut«, sagte Benjamin.
An diesem Nachmittag machten sie sich auf den Weg, um Tom zu suchen. Ren schaute in O’Sullivans Taverne nach, und Benjamin klapperte drei Bordelle in der Darby Street ab, aber kein Mensch hatte ihn gesehen. Auf dem Rückweg zur Pension kauften sie eine Tüte Walnüsse, und Benjamin knackte eine nach der anderen am Küchentisch, pulte den Kern heraus und aß sie alle auf.
»Bestimmt taucht er bald wieder auf«, sagte Benjamin. Aber Ren merkte, dass er sich Sorgen machte.
Zusammen gingen sie nach oben, um nach Dolly zu sehen. Als sie sich dem Treppenabsatz näherten, konnten sie ihn schnarchen hören. Im Zimmer kniete sich Benjamin auf den Boden und begutachtete den Mann unter der Matratze wie ein Möbelstück, von dem er nicht genau wusste, ob er es behalten sollte.
»Ich weiß nicht, warum er so viel schläft.«
»Offenbar hat er es nötig«, sagte Ren.
Benjamin stand auf und klopfte sich den Staub von den Knien. »Ich weiß ja nicht, wie es dir geht«, sagte er, »aber wenn ich eine zweite Chance im Leben hätte, würde ich sie nutzen.«
Für das Abendessen war nicht mehr viel da. Die Mausefallenmädchen hatten kurzen Prozess mit den Vorräten gemacht, genau wie der Zwerg prophezeit hatte, aber ein bisschen gepökeltes Schweinefleisch und Kartoffeln waren noch übrig. Benjamin schnitt das Fleisch in Stücke und briet es im Schweinefett. Er schnitt ein paar Kartoffeln in Scheiben und warf sie obendrauf. Dann schlug er ein halbes Dutzend Eier von den Hühnern im Hof darüber und schob alles zusammen in den Herd. Als er die Pfanne herausholte, war die Mischung gestockt, und er schnitt sie in Stücke wie einen Kuchen.
»Was ist das?«, fragte Ren.
»Das habe ich in Mexiko kennengelernt«, sagte Benjamin.
Ren probierte ein Stück. Es hatte eine eigenartige Konsistenz. »War es da furchtbar schrecklich?«
Benjamin blies auf seine Gabel. »Gut war es nicht. Aber einige Männer fanden Gefallen daran.«
Ren versuchte sich vorzustellen, was für Männer das gewesen sein mochten. Dann wurde ihm klar, dass sie vermutlich so waren wie Dolly. Er stocherte an einem Kartoffelstückchen herum. »Wusstest du, dass sie mich zur Armee geschickt hätten?«
»Pater John hat so etwas erwähnt.«
»Ist das der Grund, weshalb du mich ausgewählt hast?«
»Einer der Gründe.«
Ren hob den Kopf. Er hatte das Gefühl, sich bedanken zu müssen. Und er tat es.
Ausnahmsweise fehlten Benjamin die Worte. Er räusperte sich und stellte die Teller zusammen. Er trug sie zur Anrichte hinüber, suchte nach einem freien Platz, um sie abzustellen, und stapelte sie dann vorsichtig auf all das andere schmutzige Geschirr, das sich angesammelt hatte, seit Mrs. Sands nicht mehr da war.
Es klopfte am Fenster. Benjamin schien erleichtert. »Das ist bestimmt Tom.«
Ren ging zur Tür, drückte mit seinem ganzen Gewicht auf die Klinke und riss sie auf. Er brachte kein Wort über die Lippen, kniff nur die Augen zusammen und blinzelte. Blinzelte noch einmal. Denn vor ihm standen Brom und Ichy. Nass, zitternd und halb verrückt vor Angst.
»Ich hab dir deine Kameraden gebracht«, lallte Tom und schob die Zwillinge unsanft ins Haus. »Jetzt sind wir endlich eine Familie.«
Die Jungen taumelten zu Boden, standen aber sofort wieder auf und flüchteten in eine Ecke, um möglichst viel Abstand und Mobiliar zwischen sich und Tom zu legen. In Rens Augen sahen sie aus wie Bettler – zerschlissene Hemden, zu kurze Hosen, die Jacken fadenscheinig und voller Löcher.
»Hast du den Verstand verloren?«, schrie Benjamin. »Wozu brauchen wir drei Jungen?«
Tom zog seinen Mantel aus, warf ihn auf den Boden und torkelte auf einen Stuhl. Ren hatte ihn noch nie so betrunken gesehen. Er konnte sich kaum auf den Beinen halten, so dass Ren sich fragte, wie er den weiten Weg bis Saint Anthony geschafft hatte, ganz abgesehen davon, was er Pater John erzählt hatte, um die Jungen zu kriegen. Dann fiel Ren wieder ein, was Bruder Joseph über Brom und Ichy gesagt hatte – dass kein Mensch sie jemals adoptieren würde –, und da wurde ihm klar, dass die Mönche von Saint Anthony die Zwillinge so bereitwillig hergegeben hatten, wie sie ihn Benjamin überlassen hatten.
Tom fischte ein aufgeweichtes Päckchen Tabak aus der Tasche und warf es auf den Tisch. Aus der anderen Tasche zog er eine Flasche. »Das sind seine Kameraden.« Tom ließ die Faust auf den Tisch krachen. »Ein Junge braucht seine Kameraden.«
»Wir schicken sie zurück«, sagte Benjamin. »Noch heute Abend.«
»Ich bin ihr Vater«, sagte Tom.
»Lass den Blödsinn.«
»Du hast Ren.«
Benjamin ging zu Brom und Ichy, die sich in der Ecke aneinander kauerten. Er hob beider Kinn an, drehte ihre Köpfe hin und her und zog sie ins Licht. Fassungslos schüttelte er den Kopf und warf beide Arme in die Luft. »Zwillinge! Von jetzt an ist uns das Unglück auf den Fersen, das spüre ich.«
Brom und Ichy hatten geheult. Ihre Augen waren gerötet, ihre Gesichter verquollen. Ren hakte sich bei seinen Freunden unter und zog sie um die Ecke und die Treppe hinauf ins Schlafzimmer. Die Zwillinge folgten ihm blind, zu erschöpft, um Fragen zu stellen. Irgendwie kamen sie ihm jünger vor als die Freunde, die er zurückgelassen hatte, wie kleine Kinder, obwohl sie fast so alt waren wie er. Ren war dankbar, sie zu sehen, und sobald sie allein waren, umarmte er beide.
»Er hat behauptet, dass er uns zu dir bringt«, sagte Brom. »Aber sicher konnten wir nicht sein.« Er sah dünn und blass aus. »Ichy wollte nicht mitkommen.«
»Doch, wollte ich schon.« »Nein, wolltest du nicht. Er hat sich im Garten versteckt und sich geweigert, seine Sachen zu holen. Und dann hat er auf dem ganzen Weg hierher geheult. Und Papa wurde wütend und hat gesagt, wenn Ichy nicht aufhört, erwürgt er uns beide.«
»Er hat gesagt, wir sollen ihn Papa nennen.«
»Er hat gesagt, wenn wir das nicht tun, erwürgt er uns auch.«
Ichy packte Ren an der Jacke. »Glaubst du wirklich, dass er uns erwürgt?«
Ren wusste, dass seine Freunde schon genug Angst ausgestanden hatten, deshalb beschloss er zu tun, was Mrs. Sands getan hätte, wenn sie hier gewesen wäre. Er holte Wasser, damit sie sich Gesicht und Hände waschen konnten. Aus dem Zimmer der Hauswirtin holte er ein paar Nachthemden und noch ein paar Steppdecken. Rasch stiegen die Zwillinge aus ihren verdreckten Kleidern und schlüpften in die Hemden, dann krochen sie nebeneinander ins Bett und zogen die Decken fest um sich.
Читать дальше