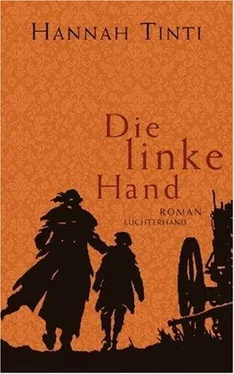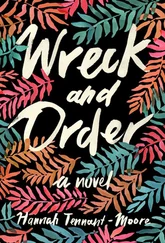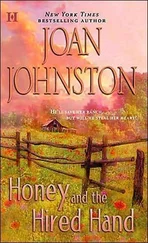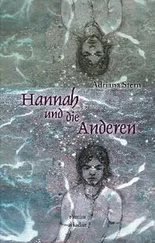»Als ich Benji kennengelernt habe, war er auf der Flucht, weil er desertiert ist. Und ich? War ich vielleicht nicht beeindruckt von ihm? Habe ich ihn nicht aufgenommen und ihm jede Freundlichkeit erwiesen, ihm ein Dach über dem Kopf besorgt und was zu essen und ihm gezeigt, wie man sich Ärger einhandelt und auch wieder rauskommt? Ich habe ihm beigebracht, Karten zu spielen und wie er es anstellen muss, damit ihn keine Frau zum Narren hält. Und jetzt sind unsere Wege so miteinander verflochten, dass sie uns am selben Strick aufknüpfen werden.«
»Er war bei der Armee?«
»Man hat ihn verkauft«, sagte Tom. »Sein Onkel hat ihn denen ausgeliefert, um eine Spielschuld zu begleichen. Sie haben ihn in den Westen geschickt, und dort hat er miterlebt, wie Männer von Schüssen zerfetzt wurden und wie sie versucht haben, sich ihre Eingeweide wieder in den Bauch zu stopfen.« Tom ließ den Kopf auf den Tisch sinken und seufzte. »Er war damals noch ein Kind. Höchstens ein paar Jahre älter als du.«
Ren setzte sein Glas ab. Dann nahm er es wieder in die Hand. Der Glasrand hatte auf dem Holztisch einen feuchten Ring hinterlassen. Eine feine durchgehende Linie. Er musste an Sebastian denken, der durch das Tor geflüstert hatte. »Ich hätte den Wunschstein gleich nutzen sollen, als ich ihn in die Finger bekommen habe.«
Die Geschichte, die Tom erzählt hatte, zerbröckelte langsam, und Ren wusste, wenn er nur lang genug wartete, würden die Worte den Raum verlassen, sich zwischen den Tischen hindurch zur Tür hinausschlängeln, und dann wäre es, als hätte er sie nie ausgesprochen. Tom war anscheinend eingeschlafen, sein Kopf lag auf beiden Armen. Ren rutschte vom Stuhl herunter, doch ehe er weggehen konnte, hob der Schullehrer das Gesicht.
»Brom und Ichy.«
»Genau«, sagte Ren.
»Hübsche Namen.« Wieder ließ Tom den Kopf sinken. »Du solltest sie nicht vergessen.«
Dolly schlief fest unter einem Ahornbaum, als Ren ihn endlich fand, und sah beinahe friedlich aus. Sein Kopf lehnte an der rauen Rinde, die Kapuze hatte er übers Gesicht gezogen. Es war ein warmer Abend. Die Bäume auf dem Gemeindeanger standen in einer Reihe da wie Bauern auf einem Schachbrett.
Ren rüttelte ihn an der Schulter. Er schrie ihm ins Ohr. Er hielt ihm die Nase zu und patschte ihm auf die Wange, aber Dolly reagierte nicht. Ren setzte sich ins Gras und sah zu, wie die Sonne unterging. Ab und zu spähte er vom Halsausschnitt in Dollys Kutte, um sich zu vergewissern, dass sich seine Brust noch hob und senkte. Er überlegte, wie viele Glieder die tätowierte Kette wohl haben mochte. Er versuchte sich vorzustellen, wie es wäre, so viele Gespenster im Nacken zu haben. Es dauerte fast eine Stunde, bis Dolly endlich die Augen aufschlug.
»Wie lang hab ich geschlafen?«
»Ungefähr hundert Jahre«, sagte Ren.
Dolly tastete nach seinen Koteletten. Er setzte sein brüchiges Lächeln auf. »Wieso bin ich dann nicht alt?«
»Bist du ja«, sagte Ren. »Man sieht es nur nicht.«
Als sie sich auf den Heimweg machten, war es auf den Straßen schon dunkel. Dolly folgte Ren wie betäubt, stolperte mehrmals über Ziegelsteine im Gehweg. Ren dirigierte ihn durch eine Gasse und an einem weiteren Häufchen Soldaten vorbei, die rauchend an der Ecke standen. Ihre Uniformen waren schmutzig, die Gewehre hingen lässig über ihren Schultern. Als Ren sich nach ihnen umdrehte, nickte ihm einer der Männer zu, wobei man die Lücken zwischen seinen braunen Zähnen sah, und Dolly gab ihm im Gegenzug seinen Segen.
Als sie zur Pension kamen, war es Nacht geworden. Sie sahen, dass die Fensterläden geschlossen waren. Ren versuchte es an der Hintertür und stellte fest, dass sie nicht abgesperrt war. Das Feuer in der Küche war erloschen. Das Messer und die restlichen Pastetenzutaten lagen noch auf der Anrichte, auch das mit Mehl bestäubte Nudelholz, aber von Mrs. Sands keine Spur. Dolly sah unbewegt zu, während Ren Küchenschübe und Geschirrschränke öffnete und den Kartoffelkorb umdrehte, die Mäntel, die neben der Tür hingen, beiseiteschob und dann polternd die Treppe hinaufrannte.
»Mrs. Sands?«
Ren schaute in den Betten im ersten Stock nach, dann lief er zum nächsten Treppenabsatz hinauf. Er stürzte in das Zimmer der Mausefallenmädchen. Es war so groß, dass vier Bettgestelle darin Platz hatten. An den Wänden hingen Spiegelscherben. Im Schrank lag ihr Sonntagsstaat – die schweren Stiefel und die marineblauen Kleider fehlten. Ren warf ein Döschen Rouge um. Dann rannte er noch eine Treppe zur Mansarde hinauf.
Als auf sein Klopfen hin niemand antwortete, stieß er die Tür auf. Das Zimmer war schmal, mit einer Dachschräge und zwei Dachluken. Unter diesen Fensteröffnungen stand ein altes Feldbett, auf das sich Mrs. Sands, noch in ihrer Küchenmontur, hatte fallen lassen.
Ihr Gesicht war gerötet, der Kragen oben am Hals aufgerissen. Ihre Hände waren voller Mehl. Ren berührte sie an der Schulter. »Mrs. Sands«, flüsterte er. Statt einer Antwort begann sie zu zittern, anfangs leicht und dann immer heftiger, so dass sie beinahe auf den Boden fiel. Ren griff nach der Decke, breitete sie über ihren Körper und hielt Mrs. Sands fest, indem er sich mit seinem ganzen Gewicht rechts und links auf die Matratze stützte.
»Du bringst mich noch um!«
»Ich versuche nur zu helfen.«
Mrs. Sands’ Blick richtete sich kurz auf Rens Gesicht. Sie streckte die Arme aus und klammerte sich an ihn. »Der ertrunkene Junge!« Sie schüttelte den Kopf. Sie zerrte an den Laken. »Ich habe noch nie jemand gesehen, der solchen Hunger hatte.«
»Was ist los mit Euch?«, fragte Ren.
»Ich nehme dir die Schüssel nicht weg. Das verspreche ich dir.« Sie packte ihn am Arm und versuchte aufzustehen. »Ich muss das Abendessen richten.« Als sie aus dem Bett stieg, musste sie so heftig husten, dass sich ihr Körper zusammenkrümmte. Sie beugte sich vor, presste die Hände auf die Rippen und begann zu schluchzen. Ein kleines Blutrinnsal tropfte aus ihrem Mund auf den Teppich.
»Dolly!«, schrie Ren. Er stürzte zur Treppe. »Dolly!«
Als Dolly die vielen Stufen heraufpolterte, hörte es sich an, als würde das gesamte Treppenhaus unter ihm zusammenkrachen. Mit tastend ausgestreckten Armen wie ein Blinder stürzte er ins Zimmer.
»Sie hat Blut im Mund.«
Dolly hockte sich in seiner Mönchskutte auf den Boden. Er betrachtete die Hauswirtin von oben bis unten, dann berührte er ihren Bauch. Mrs. Sands stöhnte.
»Lass das!«, sagte Ren.
»Sie ist krank.«
»Ich weiß«, sagte Ren. »Los, hilf mir.«
Gemeinsam legten sie Mrs. Sands wieder aufs Bett und wickelten sie in eine Decke. Ren hatte schon in Saint Anthony miterlebt, wie Kinder an so einem Fieber erkrankten. Wenn sie Blut spuckten, verlegte Bruder Joseph sie in einen anderen Raum. Und wenn die Mönche zu lange warteten, bis sie einen Arzt holten, musste bald ein neues Grab auf dem Gelände neben der Kapelle angelegt werden.
Dolly trug Mrs. Sands nach unten, während Ren den Knopf von Benjamins Bettpfosten abschraubte. Sie würden Geld brauchen, überlegte er und nahm alles mit. Das Pferd und der Wagen standen im Stall. Es dauerte eine Weile, bis sie die Stute ordentlich angeschirrt und Mrs. Sands hinten im Wagen untergebracht hatten. Ren hörte, wie sie hustete, umklammerte mit seiner unversehrten Hand die Zügel und hoffte, er würde sich im Dunkeln an den Weg erinnern.
Sie brauchten fast eine Stunde, bis sie die Brücke erreicht hatten. Dreimal war Ren falsch abgebogen. Dolly konnte sich nicht an den Weg erinnern, und Mrs. Sands war, schweißgebadet, in einen unruhigen Schlummer gefallen. Im Vorbeifahren sah Ren Gestalten in den schmalen Gassen, ein paar Schatten, die sich um ein Feuer drängten, einen Landstreicher, der an einer Hauswand lehnte, eine alte Frau, die den Rock bis zur Taille hochgehoben hatte und ihn wieder fallen ließ, als sie sah, dass sie vorbeifuhren. Er blickte stur geradeaus, als bemerkte er nichts von alledem, und als er die Brücke erspähte, seufzte er erleichtert auf. Jetzt gab es nur noch eine Straße zum Krankenhaus.
Читать дальше