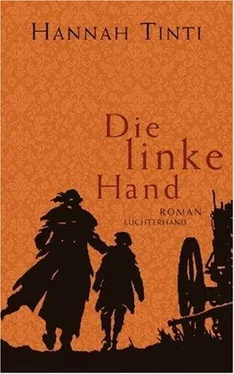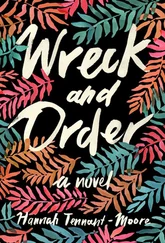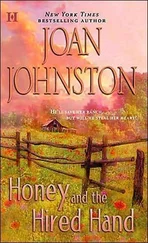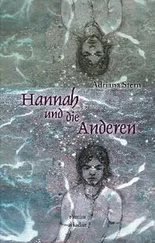»Aber nein«, sagte Benjamin und begab sich vorsorglich außer Reichweite. »Aber ich glaube, dass du uns in gewisser Weise was schuldest. Nicht dass ich einer von der Sorte wäre, die Schulden eintreiben.« Er räusperte sich. »Trotzdem denke ich, es ist an der Zeit, dass wir übers Geschäft reden.«
»Du willst, dass ich einen umbringe?«, fragte Dolly.
Benjamin schien verblüfft. »Aber nicht doch.«
»Dann kann ich dir nicht helfen.«
Benjamin biss die Zähne zusammen und rieb sich die Hände, wie immer, wenn er jemanden dazu überredete, gegen seine innere Überzeugung zu handeln. »Wir brauchen noch einen Mann«, sagte er. »Jemand, der uns beim Graben hilft.«
»Ich arbeite allein.«
»Es bringt Geld. Wahrscheinlich mehr, als du sonst in einem Jahr zu Gesicht bekommst.«
Dolly rieb den Ärmel seiner Kutte unter dem Kinn hin und her und überlegte.
Benjamin gab Ren das Messer zurück. »Komm, ich spendier dir was zu trinken«, sagte er zu Dolly und knipste sein Lächeln an, heiter und strahlend und wunderschön. Ren sah zu, wie Dolly langsam kapitulierte und selbst ein schiefes Grinsen aufsetzte. Benjamin gab Dolly die Hand und schüttelte seine Wurstfinger. »Ich kenne auch genau den richtigen Ort dafür.«
Er geleitete sie über den Gemeindeanger vor der Kirche; mit einem Arm schob er Ren vorwärts, den anderen hatte er über Dollys massige Schulter gehängt. Sie kamen an einem baufälligen Musikpavillon vorbei und an einem mit Unkraut überwucherten Teich. Benjamin zeigte hinüber zur Straße. Dort, gegenüber dem Anger, war eine belebte Taverne. Doch als sie darauf zugingen, zögerte Dolly.
»Diese Leute«, sagte er, »die kenn ich.«
Vor der Taverne standen zwei junge Männer und rauchten Pfeife. Der eine trug einen schwarzen flachen Filzhut, der andere, ein unangenehm aussehender Kerl, geknöpfte Gamaschen, die bis zu den Knien hinaufreichten.
»Wer ist das?«, fragte Benjamin.
»Hutmänner«, sagte Dolly.
»Und? Sind die gefährlich?«
»Wenn sie mich sehen, gibt’s Ärger.«
Benjamin sog die Luft durch die Zähne ein. »Dann werden sie dich eben nicht sehen.« Er zog Dolly die Kapuze übers Gesicht und führte ihn hinter eine gewaltige Eiche. »Warte hier«, sagte er. »Bleib außer Sichtweite.« Dann nahm er Ren am Arm und ging an den Hutmännern vorbei in O’Sullivans Taverne.
Es gab kein nennenswertes Schild, nur der Name – Dennis O’Sullivan – und ein Datum waren in eine vorspringende Granitplatte über dem Eingang graviert. Hinter der Tür hingen Laternen an Wandhaken und an zwei langen Ketten über dem Tresen. Ein orangeroter Schimmer lag auf den Gesichtern der Männer und warf Schatten, vor allem in den Ecken, wo die Laternen längst ausgebrannt und nicht mehr nachgefüllt worden waren. Die Tische waren aus unbehandeltem Ahornholz, die Platten glatt geschliffen von hundert Jahren Bier und Kartenklopfen. Legte man den Kopf aufs Holz, konnte man das alles in der Maserung riechen – Tausende von schmutzigen, fettigen Händen und den säuerlichen Hopfengeruch. Auf dem unebenen Boden standen Stühle auf wackeligen Beinen. Schwere Bänke, kreuz und quer von Messerkerben durchzogen. Die Sitzflächen hatten sich endgültig erschöpften Männerhinterteilen angepasst.
Die Schenke war voll. Die Gäste sahen kaum auf, als Benjamin und Ren sich durch die Menge schlängelten. Es wurde wenig gesprochen im Raum. Das hier waren ruhige Männer, Männer, die sich schon seit dem Vortag oder vielleicht noch länger bei O’Sullivan aufhielten.
Benjamin und Ren entdeckten Tom im hinteren Teil der Taverne, umgeben von leeren Gläsern; gerade versuchte er sich wieder eines einzuschenken. Er wirkte um Jahre gealtert. Die Tränensäcke unter seinen Augen waren dunkel, und er hatte Falten im Gesicht, Furchen, die seine Wangen durchzogen. Ren zwängte sich ihm gegenüber in die Nische, und Benjamin nahm den Stuhl am Kopfende.
»Wir haben einen neuen Mann.«
Tom setzte sich erschrocken auf. »Den kannst du nicht behalten.«
Benjamin stellte seinen Fuß auf die Bank. »Du hast selber gesagt, dass wir Hilfe brauchen.«
»Jemand hat ihn umgebracht«, sagte Tom. »Glaubst du nicht, die kriegen mit, dass er wieder munter rumläuft?«
»Die Männer, die ihn umgebracht haben, hat er schon erledigt.«
Tom wandte sich Ren zu. »Stimmt das?«
Ren hatte ein schlechtes Gewissen, weil er antwortete. »Er hat mir erzählt, dass er ihre Gesichter platt getreten hat.«
Tom stierte in sein leeres Glas. »Ich mag mich nicht mit einem Mörder einlassen.«
»Mit seiner Hilfe könnten wir doppelt so viele rausholen.« Benjamin gab Ren eine Münze. »Hol mir ein Bier.«
Ren wäre gern dageblieben, doch als Benjamin ihm einen zweiten Blick zuwarf, manövrierte er sich aus der Nische und bahnte sich den Weg zum Tresen. Er wusste, dass es eine Zeit lang dauern würde, bis Tom überredet wäre, und er fragte sich, ob sie Dolly so lang allein lassen konnten.
Der Schankkellner schlief anscheinend. Sein Körper hing zusammengesackt über einem Hocker, sein Kopf lag neben einem Teller Suppe auf der Theke. Der Inhalt des Tellers hatte sich über das Holz und die ohnehin schon fleckige, verdreckte Schürze ergossen, und sein Kopf war umringt von einer Batterie leerer Krüge. Ren schaute sich um, weil er nicht recht wusste, wie er ihn wecken sollte, aber niemand erwiderte seinen Blick.
Ein Mädchen mit einem Tablett voll frisch eingeschenkter Krüge ging an ihm vorbei. Sie war etwa zwölf Jahre alt, und sie bewegte sich vorsichtig und zielstrebig zwischen den Gästen hindurch. In ihren durchstochenen Ohrläppchen hingen kleine Ringe, und ihre Haut war blass und leicht grünlich. Sie brachte das Bier an einen Tisch mit Karten spielenden Männern, kehrte dann wieder an den Tresen zurück, und stellte die leeren Gläser auf ihr Tablett. Ren gab Benjamins Bestellung auf.
Das Mädchen nickte. Ihr Haar fiel in einem kerzengeraden blonden Zopf den Rücken hinunter, und Ren musste an das Mädchen denken, das ihm einen Penny in den Mund gesteckt hatte, an ihre Locken, so schwarz wie Rabenflügel. Dieses Mädchen war nicht annähernd so hübsch, aber ihre Augen waren haselnussbraun, und Ren hatte noch nie ein Mädchen mit nussbraunen Augen gesehen. Er sah ihr nach, als sie durch eine Schwingtür verschwand. Nur wenige Augenblicke später kam sie mit einem vollen Krug zurück.
»Da«, sagte sie, und Ren gab ihr das Geld. Sie stellte das Bier auf den Tresen, hob ihren Rock etwas hoch und zupfte sich Schorf vom Knie.
»Danke«, sagte Ren.
Das Mädchen betrachtete ihn genauer. »Was ist mit deiner Hand passiert?«
Ren versuchte sich etwas Interessantes einfallen zu lassen, aber der Anblick der feinen blonden Härchen am Oberschenkel des Mädchens verscheuchte vorübergehend jeden Gedanken aus seinem Kopf. »Ein Löwe hat sie gefressen«, sagte er schließlich, um eine von Benjamins Geschichten auszuprobieren. »Er ist aus dem Zirkus entflohen. Und er hieß Pierre.« Aus seinem Mund klangen die Worte unglaubwürdig.
Das Mädchen hörte auf, an dem Schorf herumzukratzen. »Du bist kein sehr guter Lügner.«
Die Tür zur Bar wurde aufgestoßen, und Tageslicht strömte herein. Drei schwarz gekleidete Männer traten ein und gingen auf Ren zu. Er war überzeugt, dass sie Dolly draußen entdeckt hatten und gekommen waren, um sie zu verhaften, doch die Männer blieben neben dem Schankkellner stehen. Der kleinste beugte sich über den Tresen, berührte ein Augenlid und schob es hoch. Die Iris darunter sah hart und glänzend aus wie eine Murmel.
»Hier hält keiner lang durch, was?«, sagte der Mann. Er griff in seine Tasche und holte einen kleinen Sack hervor, den er dem Schankkellner rasch über den Kopf stülpte und im Nacken verknotete. »Wo ist der Patron?«, fragte er das Mädchen.
Читать дальше