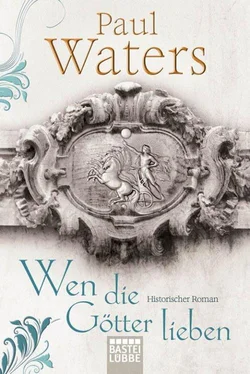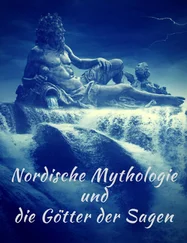Während Marcellus fort war, kam es zu einer Begegnung mit Rufus.
Ich war zu den Ställen hinaufgegangen und stand mit dem Quartiermeister in dem überdachten Eingang zum Getreidespeicher, wo wir die Vorräte inspiziert hatten, als ich Rufus am anderen Ende des Hofes bemerkte. Er führte seine graue Stute am Zügel.
Marcellus konnte das Befinden eines Pferdes schon von weitem erkennen. Ich hatte einiges von ihm gelernt und sah deshalb, dass Rufus’ Stute niedergeschlagen war. Sie lief schleppend, hatte die Ohren zurückgelegt und zog und sträubte sich bei jedem Schritt. Rufus hatte Pferde immer mit warmer Zuneigung behandelt. Ich fragte mich, als ich das Gespräch mit dem Quartiermeister beendete, was daraus geworden war.
Rufus war stehen geblieben und schien einem der Stalljungen Vorhaltungen zu machen. Er entließ ihn mit einem Schubs, riss die Stute am Zügel weiter und drehte zornig den Kopf nach ihr, als sie empört wieherte. Dabei bemerkte er ein wenig erschrocken, dass ich ihn beobachtete.
»Ist sie krank?«, fragte ich.
»Sie ist faul, ein ungeschicktes Miststück. Sie hat ein paar Schläge nötig und muss lernen, wer der Herr ist.«
Ich musterte das traurige, widerspenstige Pferd und dann Rufus. Sein Gesicht war fleckig, seine Augen matt und abgespannt. Und er hatte diesen höhnischen Zug um den Mund bekommen, den jeder in Nevittas Gefolge hatte.
Bei Nevittas übrigen Freunden schien sich das naturgemäß zu entwickeln, als ob sie bei ihrem vulgären Zeitvertreib zu ihrem wahren Charakter fänden. Doch Rufus stand es schlecht zu Gesicht. Er erinnerte mich an ein Kind, das die schlechten Angewohnheiten eines unanständigen Erwachsenen nachahmt. Es betrübte mich, seinen Niedergang zu sehen, und ich dachte voller Zorn an Nevitta, der Rufus angezogen hatte wie die Flamme den Falter, um ihn nach und nach zu derben Vergnügungen zu verleiten, gerade als die inneren Qualen den jungen Mann schwach und orientierungslos machten.
Ich richtete meinen Blick wieder auf die Stute. Dieses einst so prächtige Tier hatte ihn offenbar hassen und fürchten gelernt. Auch der Stalljunge schien das erkannt zu haben. Vielleicht war es bei der Auseinandersetzung zwischen ihm und Rufus genau darum gegangen.
Er war bei mir stehen geblieben, obwohl ich nichts tat, um ihn aufzuhalten. Unruhig trat er von einem Bein aufs andere und warf mir unbehagliche Blicke zu, um sogleich hastig wegzuschauen – auf die Pflastersteine, auf sein Pferd oder die sand-und ockerfarbenen Mauern. Vielleicht hatte er mir angesehen, was ich dachte, und es hatte ihn an damals erinnert.
Ich wandte mich zum Gehen. Es war nicht meine Absicht, mich ihm aufzudrängen. Doch in dem Moment sprudelte es aus ihm hervor: »Ich habe Marcellus gesehen, er war bei Nevittas Bankett. Nevitta hatte ein paar Mädchen aus der Stadt eingeladen, genug für jeden.« Er machte eine derbe Geste, damit ich verstand. »Aber er war an seinem Mädchen nicht interessiert. Als sie sich zu ihm setzte, redete er bloß mit ihr. Nevitta mag Leute, die mitmachen.«
Ich nehme an, dass Rufus nur versuchte, nett zu sein, und dass er mit mir über Dinge plaudern wollte, die ihm gerade in den Sinn kamen. Doch er war schon zu lange bestrebt, Nevittas Korona nachzueifern, sodass seine harmlosen Worte wie ein höhnischer Seitenhieb wirkten. Das schien auch er zu bemerken, denn er senkte beschämt den Blick, und ich sah seine fleckigen Wangen erröten.
»Ja, ich habe davon gehört«, sagte ich. Ich war nicht wütend auf ihn, war aber auch nicht geneigt, mit ihm über Marcellus oder Nevittas Gelage zu reden. Denn jedes meiner Worte würde Nevitta zugetragen.
Deshalb sagte ich nur: »Pflege deine Stute gut, Rufus, eines Tages könnte dein Leben von ihr abhängen.«
Dann ließ ich ihn allein. Ich empfand eine tiefe, allumfassende Traurigkeit und wünschte, ich hätte die Welt für ihn ändern können. Doch man darf einem anderen seine Hilfe nicht aufdrängen, wenn er sie nicht will. Dennoch beschloss ich, ein Auge auf Rufus haben, falls die Zeit käme, wo er Nevitta leid war.
Voller Trauer schaute er mir hinterher, und das bemitleidenswerte Tier neben ihm drehte den Kopf und sah mich kläglich an.
Während dieser Zeit legte ein Handelsschiff im Hafen an, das Öl aus Karthago an Bord hatte. Der Kapitän kam ohne Umwege in den Palast, um Neuigkeiten loszuwerden. Gaudentius, der Notar, der beinahe eine Meuterei ausgelöst hätte, als wir gegen die Franken kämpften, war von Constantius nach Afrika geschickt worden, damit er die Getreidelieferung nach Gallien kappte.
»Ich habe Verwandte in Marseilles«, erklärte der Kapitän, »habe jedoch angegeben, die Fracht nach Ostia zu bringen, sonst hätten sie mich nicht ablegen lassen.«
»Wir sind dir dankbar«, sagte Eutherius, der ihn vorgelassen hatte, und schrieb eine Anweisung. »Bring dies zum Kämmerer; er wird dich für deine Mühe entschädigen.«
Sobald der Kapitän gegangen war, sagte Julian: »Was hältst du davon? Will er Sizilien besetzen?«
Eutherius schüttelte den Kopf. »Gaudentius ist nicht der Mann dafür. Er ist bloß ein Bürokrat und Unheilstifter. Außerdem würde er ein Jahr benötigen, um ein Invasionsheer zu sammeln, und selbst dann hätte er nicht die Schiffe, um es zu transportieren. Doch er kann in Afrika seine Macht gegen dich entfalten und die Getreidelieferungen einschränken.«
Als das Wetter wärmer wurde und die Schäfer ihre Herden auf die oberen Weiden trieben, kamen Händler über die schneefrei gewordenen Alpenpässe und berichteten von schlecht verborgenen Nachschublagern in den bewaldeten Vorbergen und von Truppenbewegungen in den Ebenen Norditaliens.
»Jetzt ist es offenkundig«, sagte Julian. »Die Frage ist nur, ob wir weiter warten und auf Frieden hoffen sollen, um Gallien zu verteidigen, wenn wir angegriffen werden, oder ob wir als Erste angreifen, und zwar in Illyrien.«
»Wir müssen angreifen, sobald Libino zurück ist!«, erklärte Nevitta mit leuchtenden Augen. »Weiteres Zögern wäre unheilvoll.«
Diesmal waren die übrigen Offiziere – Dagalaif, Arintheus, Valentinian – seiner Meinung. Es gab bereits Gerüchte, wonach der Perserkönig sich von der Grenze im fernen Osten zurückzog. Noch hörte man nichts Genaues, doch wenn die Gerüchte stimmten, hieß das, dass Constantius mit den Persern ein Abkommen getroffen hatte. Wenn seine östliche Flanke befriedet war, konnte er sich mit der gesamten Streitmacht dem Westen zuwenden – uns.
»Warum sollte Constantius sonst vom Euphrat nach Antiochia zurückkehren?«, sagte Nevitta. »Er bereitet einen Feldzug vor – es kann nichts anderes bedeuten. Illyrien ist reich an Männern, dort rekrutiert Constantius seine Soldaten. Ich sage, entreiße es ihm sofort.«
»Und du, Drusus?«, fragte Julian. »Was denkst du?«
Ausnahmsweise stimmte ich Nevitta zu. »Constantius will uns hier festhalten, bis er selbst so weit ist«, antwortete ich. »Darum hat er Vadomar auf uns gehetzt; darum hat er Gaudentius nach Afrika geschickt.«
Julian rieb sich das Kinn und schaute durch den Raum. »Eutherius, du hast dich noch nicht dazu geäußert.«
Nevitta drehte den Kopf. Ich sah, wie er die Zähne zusammenbiss. Nach kurzem Zögern sagte Eutherius: »Illyrien hat Gold-und Silberminen, und unsere Mittel sind knapp geworden.«
»Das entscheidet die Sache!«, rief Nevitta und schlug mit der flachen Hand auf den Kartentisch wie ein Spieler, der beim Würfeln gewonnen hat.
Bei dem dumpfen Schlag zog Eutherius die Brauen hoch und begegnete Nevittas Blick, unbeeindruckt von der prahlerischen Lautstärke.
»Nevitta, der Heerführer Illyriens ist ein Mann namens Lucillian. Hast du von ihm gehört? Er ist sehr erfahren – keiner eurer unfähigen Barbarenhäuptlinge. Dennoch«, fuhr er fort und hob die Hand, als Nevitta ihm ins Wort fallen wollte, »ist nun eindeutig, dass Constantius seine Streitkräfte nach Westen wenden wird, auch wenn er es heimlich tut. Aber Vorbereitungen von diesem Umfang lassen sich nicht verbergen. Es wird einige Zeit brauchen, um solch ein mächtiges Heer neu zu ordnen, aber es wird umso schlimmer für uns, sobald es geschehen ist. Wenn wir angreifen wollen, dann am besten, ehe Constantius selbst so weit ist.«
Читать дальше