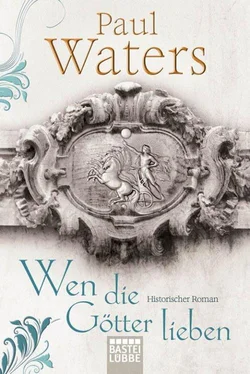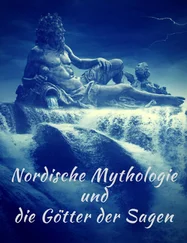Julian nickte aufgebracht. Das brauchte man ihm nicht zu sagen; er hatte fünf Jahre lang versucht, die Schäden von damals wettzumachen.
»Das ist eine vorsätzliche Beleidigung!«, brauste Nevitta mit solcher Vehemenz auf, dass alle ihn erstaunt musterten.
Von seinem Sessel in der Ecke sagte Eutherius gelassen: »Eine Beleidigung vielleicht, aber sie enthüllt ihren Zweck, wenn wir sie mit klarem Kopf betrachten. Mit Vadomar im Rücken kannst du Gallien nicht verlassen, und Constantius weiß das. Er will dich hier festhalten, bis er gegen dich zu Felde ziehen kann.«
Julian wandte sich der Karte zu, die auf dem Tisch ausgebreitet lag. Einen Moment lang überlegte er. »Wie bald können unsere Soldaten an der rätischen Grenze sein?«
»In zehn Tagen«, antwortete Nevitta. Er trat an den Tisch und tippte mit dem Finger auf die Karte, wo die Straße an der Rhone entlang zu den Bergen Rätiens führte. »Die Petulantes kennen sich dort aus. Lass sie von Libino anführen. Er ist bereit … und wir haben schon viel zu lange abgewartet!« Er hob den Kopf und warf Eutherius einen feindseligen Blick zu. »Oder willst du vorschlagen, es selbst jetzt noch hinauszuzögern?«
Den ganzen Winter hatten sie darüber gestritten – Nevitta, der meinte, das Heer solle im Osten angreifen, sobald die Pässe schneefrei seien, und Eutherius, der riet, sich zurückzuhalten, solange man noch auf eine Einigung mit Constantius hoffen könne. Mitten in dieser Auseinandersetzung, in einem jener seltenen Augenblicke, in denen er sich seinen Ärger anmerken ließ, hatte Eutherius zu mir gesagt: »Wirklich, Drusus, unser Freund Nevitta ist kein geborener Zuhörer. Er hat den Westen noch nie verlassen; er kann sich nicht vorstellen, was für eine Streitmacht Constantius befehligt.«
Ich pflichtete ihm bei. Ich sagte nicht, dass Nevitta ihn nicht leiden konnte. Der Heermeister war in der rauen Welt der Grenzkastelle aufgewachsen. Er hatte einen germanischen Vater, doch sein spitzes Mausgesicht und die dunklen Haare hatte er von seiner Mutter, die Gerüchten zufolge eine syrische Kurtisane gewesen sein soll. Seine Erziehung hatte sich aufs Kämpfen und Töten beschränkt. Er betrachtete Eutherius als einen grotesken Angriff auf die Natur; die geschmeidige Ausdrucksweise, das geschlechtslose Auftreten und die leuchtenden Kleider Eutherius’ verstießen auf geradezu empörende Weise gegen Nevittas Vorstellung von Männlichkeit.
Natürlich achtete er darauf, dass Julian nichts davon bemerkte; seine Verstellung in dessen Gegenwart war die einzige Art von Selbstbeherrschung, die ich je an Nevitta beobachten konnte. Unter seinen lauten, Bier trinkenden Freunden war er nicht so vorsichtig, wie Marcellus wusste, da er schon selbst dabei gewesen war.
Eutherius dürfte es ebenfalls gewusst haben, denn er versuchte stets zu erkennen, was sich hinter den Untertönen schlechter Gesinnung verbarg. Doch er war zu höflich, zu sehr Diplomat und zu sehr an dumme Männer gewöhnt, als dass er sich etwas hätte anmerken lassen.
Diesmal begegnete er Nevittas wütendem Blick mit weltmännischem Lächeln. »Du hast ganz recht, mein lieber Nevitta. Mit Vadomar müssen wir ohne Frage fertig werden. Was Constantius betrifft, so will er uns zweifellos in Aufregung versetzen und dadurch, wenn er Glück hat, Streit unter uns entfachen.«
Er hielt kurz inne für den Fall, dass Nevitta das entscheidende Argument entgangen sein sollte; dann fuhr er fort: »Also führe Krieg gegen Vadomar. Aber lass uns auch bedenken, wo Constantius’ große Schwäche liegt.«
»Und wo wäre das?«, fragte Nevitta verärgert.
»In seinem ausweichenden Charakter. Er kann sich nicht entscheiden. Entschlossenheit ist ihm fremd. Vadomar ist eine Ablenkung – und wir dürfen uns durch unsere Empörung nicht von unserer Strategie abbringen lassen.«
Nevitta rümpfte die Nase über Eutherius’ Tonfall. Seine Kritik hob er sich für später auf, wenn er in der Offiziersmesse saß.
Schließlich sagte Julian: »Also gut, du wirst Libino nach Rätien schicken. Marcellus, du gehst mit ihm. Zeigt Vadomar – und Constantius –, dass wir uns nicht zum Narren machen lassen.«
Zwei Tage später, an einem klaren, kalten Morgen, stieg ich auf den Hügel der Zitadelle, von wo man über ganz Vienne blicken kann, und ging allein den gestuften Weg hinter dem Theater hinauf. Vom Tempel auf dem Gipfel aus beobachtete ich, wie die Soldaten mit Libino an der Spitze und Marcellus an seiner Seite abmarschierten.
Am Abend hatte Nevitta noch eines seiner Bankette abgehalten. Marcellus, der sie verabscheute, hatte daran teilgenommen, weil sein Fehlen aufgefallen wäre. Nevitta erwartete von seinen Offizieren, dass sie bei seinen Trinkgelagen mitmachten. Marcellus war so früh wie möglich von dort verschwunden. Als er ins Bett kam, sagte er: »Libino wird morgen einen schweren Kopf haben. Als ich ging, fing er gerade erst richtig an.«
»Das sieht ihm ähnlich.«
Libino war einer von Nevittas großspurigen jungen Kriegern, frisch befördert – von Nevitta selbst – und erpicht, sich zu beweisen. Ich stützte mich aufs Kissen und schaute Marcellus beim Auskleiden zu. Ich konnte den Kaminrauch und den Wein an ihm riechen.
»Nur ein Narr feiert den Sieg vor der Schlacht«, sagte er und tappte barfuß zur Lampe, um die Flamme zu löschen. »Ich saß neben Jovinus. Er sagt, dass die Petulantes nicht froh sind.«
»Nun, jeder weiß, dass er sie anführen wollte. Er meint, er hätte eher befördert werden müssen als Libino.«
»Und damit hat er recht. Er weiß, was er tut. Er redet immer vernünftig, und er kennt die Männer.«
Wir sprachen noch ein wenig über Jovinus. Er war ein guter Soldat – nicht laut oder energisch, also gar nicht der Mann, den Nevitta begünstigen würde.
Meine Augen gewöhnten sich an die Dunkelheit. Gegenüber lag Marcellus im blassen Mondlicht, das durch die Ritzen der Fensterläden fiel, und starrte an die Decke, die Hände hinter dem Kopf gefaltet.
»Was hast du?«, fragte ich leise. »Dich beschäftigt etwas.«
Er antwortete nicht gleich. Dann stieß er einen tiefen Seufzer aus. »Ach, nichts … Nevitta vermutlich. Diese Gelage, das Geschrei, das Wettsaufen, die aufdringlichen Kurtisanen, die zum Einschlafen langweilig sind, das alles ist mir zuwider. Und wenn man nicht mitmacht, denkt er, man beleidigt seinen Geschmack.«
Ich lachte. »Seinen Geschmack? Neben Nevittas Besäufnissen erscheint jede Barbarenhochzeit wie eine Nachtwache im Garten der Vestalinnen.«
Ich sah, wie sich sein Mund zu einem Lächeln verzog. »Wie auch immer«, sagte er und drehte sich auf die Seite, um mich anzusehen. »Die Petulantes sind tüchtige Soldaten, und ein Feldzug wird mir guttun. Ich bin das Winterquartier leid. Besonders das prahlerische Gerede, was wir Constantius alles antun werden.«
»Ja«, sagte ich und verfiel in nachdenkliches Schweigen.
Unbehagen war über mich gekommen wie ein eisiger Windstoß. Ich hatte mir über Libino noch nie Gedanken gemacht; er war nur einer von Nevittas Angebern und so nervtötend wie die übrigen. Doch jetzt, als ich in die Dunkelheit starrte, sah ich ihn als den gefährlichen jungen Dummkopf, der er war, unbeliebt und zu Unrecht befördert. Ich ahnte Unheil und schob den Gedanken beiseite.
Schließlich sagte ich: »Du musst an deine eigene Einheit denken. Das reicht. Lass Libino selbst auf sich aufpassen … Marcellus?«
Er antwortete nicht, und als ich lauschte, hörte ich ihn ruhig und gleichmäßig atmen.
Ich lächelte. Ich hatte überlegt, mich zu ihm ins Bett zu legen und eine Weile zu plaudern. Ich wollte ihn an mir spüren. Aber es war besser, ihn schlafen zu lassen. Er würde am Morgen früh aufbrechen und hatte einen langen Marsch vor sich.
Doch ich selbst lag noch lange wach und starrte auf die Umrisse von Mondschein und Schatten.
Читать дальше