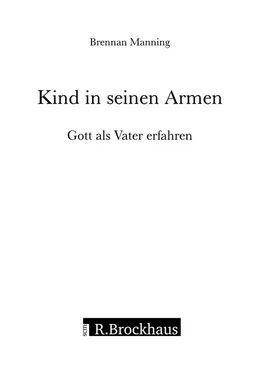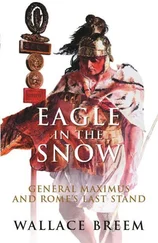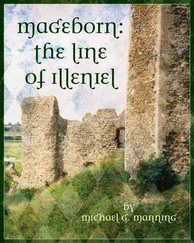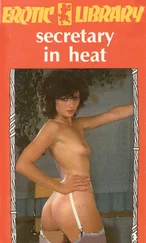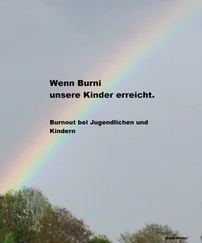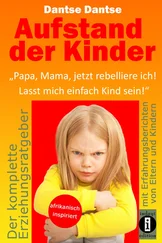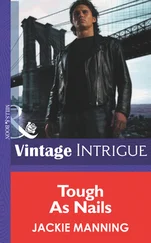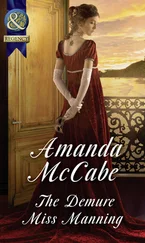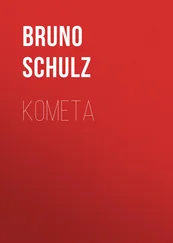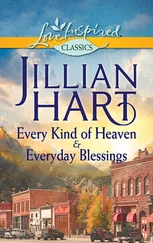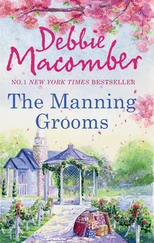Brennan Manning - Kind in seinen Armen
Здесь есть возможность читать онлайн «Brennan Manning - Kind in seinen Armen» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Kind in seinen Armen
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Kind in seinen Armen: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Kind in seinen Armen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Brennan Manning lädt dazu ein, Gott neu kennenzulernen und alte Denkmuster aufzugeben. Denn der Autor hat selbst erfahren: Gott liebt uns so, wie wir sind, und er brennt darauf, uns wie ein gütiger Vater in die Arme zu schließen.
Kind in seinen Armen — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Kind in seinen Armen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
»Es ist vorbei. Das sonderbare Misstrauen, das ich gegen mich, gegen meine Person hegte, hat sich wohl für immer verflüchtigt. Dieser Kampf ist zu Ende. Ich verstehe ihn nicht mehr. Ich bin mit mir selbst versöhnt, versöhnt mit dieser armen, sterblichen Hülle.
Es ist leichter, als man glaubt, sich zu hassen. Die Gnade besteht darin, dass man sich vergisst. Wenn aber endlich aller Stolz in uns gestorben ist, dann wäre die Gnade der Gnaden, demütig sich selbst zu lieben als irgendeines der leidenden Glieder Christi.« 15
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
2. Der Schwindler
Eine Maske aufbauen
Leonard Zelig ist der Inbegriff des Nebbich (jiddisch für Nichtsnutz). In Woody Allens heiterem und nachdenklichem Film Zelig ist er ein gefeiertes Nichts, das überall hinpasst, weil es sich jeder beliebigen Situation anpassen kann. Zelig reitet in einer Parade durch den Heldencanyon von Mohalles; er steht zwischen den ehemaligen US-Präsidenten Herbert Hoover und Calvin Coolidge; er albert mit Preisboxer Jack Dempsey herum und plaudert mit Bühnenautor Eugene O’Neill übers Theater. Als Hitler seine Anhänger in Nürnberg versammelt, steht Leonard natürlich mit auf dem Podium.
»Er hat keine eigene Persönlichkeit, deshalb schlüpft er in die Rolle jeder starken Persönlichkeit, der er begegnet. Bei den Chinesen kommt er geradewegs aus China. Trifft er einen Rabbi, wachsen ihm auf wundersame Weise Bart und Schläfenlocken. Er äfft den Jargon der Psychiater nach und streicht sich mit feierlichem Ernst übers Kinn. Im Vatikan gehört er zum geistlichen Gefolge von Papst Pius XI. Im Frühjahrsmanöver trägt er eine Yankee-Uniform und steht im Baseballkreis, um Babe Ruth, den berühmtesten Baseballspieler Amerikas, zu schlagen. Er nimmt die schwarze Haut des Jazztrompeters an, die Speckrollen eines Dickwansts, das Profil eines Indianers. Er ist ein Chamäleon. Er verändert Hautfarbe, Akzent und Gestalt, sowie die Welt um ihn herum sich verändert. Er hat keine eigenen Ideen und Meinungen, er passt sich einfach an. Er möchte nur sicher sein, dazugehören, akzeptiert und gemocht werden … Er ist berühmt dafür, ein Nichts zu sein, ein Nicht-Mensch.« 16
Ich könnte über Allens Karikatur des Menschen, der allen gefallen will, hinweggehen, wenn ich nicht so viel von Leonard Zelig an mir selbst entdecken würde. Der absolute Schauspieler folgt meinen egoistischen Wünschen. Er trägt tausend Masken. Die glänzende Fassade muss um jeden Preis aufrechterhalten werden. Der fromme Hochstapler und Maskenträger zittert bei dem Gedanken, er könnte das Missfallen oder den Zorn der anderen auf sich ziehen. Unfähig zur direkten Rede, windet er sich; er quasselt und zaudert und schweigt aus Angst vor Ablehnung. »Das falsche Ich spielt seine trügerische Rolle, indem es uns angeblich schützt – doch in einer Weise, die darauf programmiert ist, die Angst in uns wach zu halten: die Angst davor, im Stich gelassen zu werden, den Halt zu verlieren, es nicht allein zu schaffen, nicht allein sein zu können.« (James Masterson) 17
Fromme Schauspieler und Hochstapler leben in der Angst. Jahrelang habe ich mich zum Beispiel gerühmt, pünktlich zu sein. Doch in der Stille und Einsamkeit der Berghütte in Colorado wurde mir klar, dass meine Pünktlichkeit in der Angst vor menschlichem Tadel wurzelte. Mahnende Stimmen von Autoritätspersonen aus der Kindheit haben sich in meiner Seele eingenistet und warnen noch heute vor Rüffeln und Strafe.
Schwindlern liegt daran, akzeptiert und gelobt zu werden. Wegen des lähmenden Drangs, anderen zu gefallen, können sie nicht mit derselben Zuversicht Nein sagen, mit der sie Ja sagen. Und so geben sie sich selbst in Menschen, Projekte und Angelegenheiten hinein, nicht aus persönlichem Interesse, sondern aus Angst, den Erwartungen der anderen sonst nicht zu entsprechen.
Dieses falsche Ich entsteht, wenn wir als Kinder nicht richtig geliebt, wenn wir abgelehnt oder verlassen werden. Der Schwindler ist der klassische Co-Abhängige. Um anerkannt zu werden, unterdrückt oder versteckt das falsche Ich die eigenen Emotionen. Ehrliche Gefühle werden damit unmöglich. John Bradshaw definiert Co-Abhängigkeit als eine Krankheit, »die von einem Identitätsverlust gekennzeichnet ist. Co-abhängig zu sein bedeutet, die eigenen Gefühle, Bedürfnisse und Wünsche nicht zu kennen«. 18Wenn wir aus einem falschen Selbst leben, wächst in uns der zwingende Wunsch, der Öffentlichkeit ein perfektes Bild von uns zu präsentieren. Alle sollen uns bewundern, aber niemand kennt uns. Das Leben des Schwindlers wird zur endlosen Achterbahn, einem Auf und Ab zwischen Hochgefühl und Depression.
Das falsche Ich braucht Erfahrungen von außen, um einen persönlichen Sinn zu finden. Das Streben nach Geld und Macht, nach Glanz oder sexuellem Heldentum, nach Anerkennung und Status stärkt die eigene Bedeutung und schafft die Illusion, Erfolg zu haben. Der Schwindler ist, was er tut.
Lange Jahre habe ich mich durch meine »Leistungen« im Dienst für Gott vor meinem wahren Ich versteckt. Durch Predigten, Bücher und Geschichten schuf ich mir meine Identität. Wenn die Mehrheit meiner christlichen Zuhörer und Leser gut von mir dachte – so versuchte ich mir selbst zu erklären –, war mit mir alles in Ordnung. Je mehr ich in den Erfolg im Dienst investierte, desto echter wurde der Hochstapler. Der Hochstapler bringt uns dazu, Unwichtiges für wichtig zu halten, das Unwesentliche mit einem falschen Glanz zu umgeben und uns vom Echten abzuwenden.
Das falsche Ich macht uns blind dafür, die innere Leere und Hohlheit zu erkennen und im rechten Licht zu sehen. Wir können nicht zugeben, dass es in uns dunkel ist. Im Gegenteil, der Hochstapler stellt seine Finsternis als das hellste Licht dar, er beschönigt die Wahrheit und verdreht die Realität. Der Apostel Johannes dagegen schreibt: »Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns.« (1. Johannes 1,8)
Weil es sich so sehr nach dem Lob sehnt, das ihm in der Kindheit vorenthalten wurde, stolpert mein falsches Ich mit einem geradezu unersättlichen Appetit nach Bestätigung in jeden neuen Tag hinein. Wenn die Fassade intakt ist, geht mir jedes Mal, wenn ich einen Raum betrete, in dem sich eine Hand voll Menschen befindet, sozusagen eine stumme Trompete voraus, die verkündet: »Da bin ich«, während mein mit Christus in Gott verborgenes wahres Ich ruft: »Oh, da seid ihr ja!« Der Hochstapler in mir wirkt ähnlich wie der Alkohol für den Alkoholiker. Er ist durchtrieben, raffiniert, stark – und heimtückisch.
Die Hauptfigur in einem der frühen Romane von Susan Howatch, Blendende Bilder, ist Charles Ashworth, ein junger und brillanter anglikanischer Theologe, der plötzlich einen völligen seelischen Zusammenbruch erleidet. Von seinem Vater entfremdet, sehnt er sich gleichzeitig nach dem väterlichen Segen. Deshalb macht er sich nun auf den Weg ins Kloster, um seinen geistlichen Vater, einen älteren Mann namens Jon Darrow, aufzusuchen. Ashworth fürchtet, als bestechlicher Kirchenmann und geistlicher Versager bloßgestellt zu werden. Sein Schwindler greift ein:
»Der Gedanke gemeinen Versagens war entsetzlich genug, aber die Vorstellung, Darrow zu enttäuschen, war unerträglich. Voller Panik sann ich auf eine Lösung, die mich in meiner Verletzlichkeit schützen konnte, und als Darrow an jenem Abend wieder in mein Zimmer trat, sagte meine blendende Fassade zu ihm: ›Ich wünschte, Sie würden mir ein bisschen mehr von sich selbst erzählen, Pater. Ich würde gern noch so viel von Ihnen wissen.‹
Kaum waren die Worte gesprochen, da spürte ich, wie ich ruhig wurde. Dies war eine unfehlbare Methode, das Wohlwollen älterer Herren zu gewinnen. Ich fragte sie nach ihrer Vergangenheit, hörte mit dem aufmerksamen Interesse des Musterschülers zu und wurde mit der dankbaren Zuwendung väterlicher Güte belohnt, die blind blieb für alle Fehler und Schwächen, die ich so verzweifelt zu verbergen suchte. ›Erzählen Sie mir von Ihrer Zeit bei der Navy!‹, drängte ich Darrow mit der ganzen Wärme und allem Charme, den ich aufbringen konnte. Doch während ich voller Zuversicht auf die Antwort wartete, die meine Angst vor der Untauglichkeit betäuben würde, schwieg Darrow … In der Stille wurden mir die Manöver meiner wendenden Fassade schmerzlich bewusst.« 19
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Kind in seinen Armen»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Kind in seinen Armen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Kind in seinen Armen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.