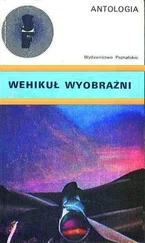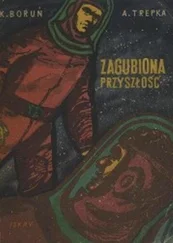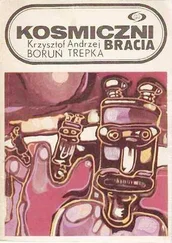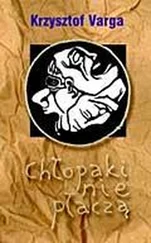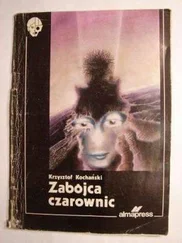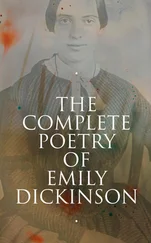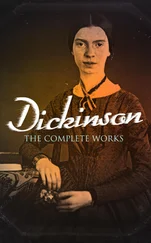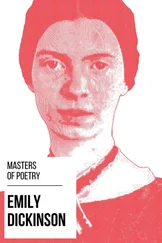Beschrieben werden hauptsächlich die aktuelle Aktivität des Klienten sowie der Bereich etwaiger Veränderungen. Wichtig ist nicht so sehr, welchen Einfluss vergangene Ereignisse auf das aktuelle Funktionieren des Klienten haben, sondern vielmehr, dass ein Verständnis für die aktuellen, individuellen und familiären Bedingungen vorhanden ist. Bestimmt wird sowohl, wie der Klient tatsächlich ist, als auch, wie er sein könnte. Es werden Hypothesen dazu aufgestellt, wie die Person (die Familie) eine gute Zukunft, mehr Lebensfreude und Zufriedenheit für sich schaffen kann, wie Krankheitssymptome abklingen können und wie der Klient wieder gesund wird. Die Vergangenheit des Klienten ist nur dann wichtig, wenn sie Informationen dazu liefert, was berücksichtigt werden muss, damit es nicht zu Rückfällen oder zum Weiterführen dessen kommt, was problematisch war (Rossi, Erickson-Klein a. Rossi 2008b). Außerdem kann auch das Kennenlernen der Vergangenheit des Klienten nützliche Informationen zu seinen Ressourcen liefern.
Im hier vorgestellten Modell umfasst die Diagnose in der ericksonschen Therapie fünf Bereiche:
•Diagnosekategorien
•Trancephänomene
•Systemreflexion
•Ressourcen
•Motivation
Einige dieser Bereiche können mehr und andere weniger ausgebaut werden, das hängt sowohl vom jeweiligen Klienten als auch von den Vorlieben des Therapeuten ab. Auch innerhalb jedes dieser fünf Bereiche ist es notwendig, dass der Therapeut auswählt, was Gegenstand der Beschreibung werden soll. Bei seiner Auswahl richtet er sich danach, was für die Psychotherapie, die durchgeführt werden soll, nützlich ist.
Die Diagnose erfüllt also viele unterschiedliche Funktionen. Für den Therapeuten ist dabei am wichtigsten, welche anwendbaren Hinweise die Diagnose bezüglich der therapeutischen Arbeit liefert. Vom Klienten wird die Diagnose oft als Suggestion wahrgenommen, weshalb der Therapeut darauf achten sollte, dass die Diagnose Hoffnung beinhaltet und als gesundheitsförderlich, statt als Einschränkung oder Behinderung, empfunden wird. Im ericksonschen Ansatz wird die Diagnose in beschreibender Form angegeben. Das hier vorgestellte Modell umfasst fünf Bereiche: die Diagnosekategorien, die Trancephänomene, die Systemreflexion, die Beschreibung der Ressourcen sowie das Bestimmen der Motivation des Klienten. In diesen Bereichen kann sowohl bei einzelnen Klienten als auch bei einer in Therapie befindlichen Familie eine Diagnose gestellt werden.
2Wo deutsche Übersetzungen bereits vorlagen, wurde daraus zitiert. Zitate, die aus englisch- oder polnischsprachigen Quellen entnommen sind, wurden im Zuge der Übersetzung dieses Werkes mitübersetzt.
3Bei der Verwendung des Begriffs Therapeut beziehe ich mich im gesamten Buch auf den Beruf des Therapeuten, unabhängig vom Geschlecht der Person, die diesen Beruf ausübt. Ebenso verwende ich hier den Begriff Klient bzw. Patient für Hilfesuchende unabhängig ihres Geschlechts.
4Die diagnostischen Aspekte anzuführen, die für eine Psychotherapie sprechen, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen und eine eigene Abhandlung erfordern.
2Ausgewählte Diagnosekategorien
2.1Einführung
Die von Jeffrey K. Zeig (1991) vorgeschlagenen diagnostischen Kategorien umfassen mehrere Ebenen. Die meisten dieser Kategorien können zwischen zwei entgegengesetzten Polen verortet werden. An einem Ende des Kontinuums befindet sich die maximale und am anderen Ende die minimale Ausprägung einer bestimmten Eigenschaft. Andere Kategorien wiederum sind beschreibend und spiegeln die Folgen wichtiger Lebenserfahrungen des Klienten wider. Die diagnostischen Kategorien nach Zeig beziehen sich auf wesentliche Aspekte des intra- und interpersonellen Funktionierens des Klienten. Sie sind ein Anhaltspunkt, der sowohl dabei hilft, eine Strategie aufzubauen, als auch dabei, verschiedene Interventionen zu formulieren, um eine gute Zusammenarbeit zu erreichen. Zeig schlägt vor, beim Beschreiben des Klienten etwa ein Dutzend Kategorien zu berücksichtigen. Dennoch kann jeder Therapeut seine eigene Liste mit den Bereichen erstellen, die er bei der Arbeit mit einer konkreten Person oder einer Familie für wichtig erachtet. Die Anzahl der Kategorien kann beliebig hoch sein, für gewöhnlich reduziert der Therapeut sie jedoch und wählt zwei oder drei Bereiche aus, in denen er die Diagnostik, und später die therapeutische Arbeit, durchführt. Der Therapeut richtet sich hierbei nach den Besonderheiten der Probleme seines Klienten sowie nach seinen eigenen therapeutischen Erfahrungen. Bei der therapeutischen Arbeit mit einer Adoptivfamilie beispielsweise ist es sehr wichtig, was die Eltern glauben, wie viel Einfluss sie auf die Erziehung ihres Adoptivkindes haben können. Adoptiveltern, die davon überzeugt sind, dass Genetik hierbei eine entscheidende Rolle spielt, werden sich anders verhalten als Eltern, die von der wirksamen Kraft der Liebe zu ihrem Kind überzeugt sind. Für die Arbeit mit Adoptivfamilien könnte man demzufolge eine diagnostische Kategorie verwenden, an deren einem Pol die Überzeugung der Eltern steht, alles sei genetisch vorherbestimmt, am anderen Pol dagegen der pädagogische Optimismus. Auch folgende Bereiche können bei der therapeutischen Arbeit mit einer Adoptivfamilie von Bedeutung sein: nach außen gerichtete Aufmerksamkeit – nach innen gerichtete Aufmerksamkeit oder Gefühl von Handlungsfähigkeit – Gefühl von Machtlosigkeit.
Verfügt der Therapeut über eine gute Kenntnis der eigenen Person, die er aus Reflexionen zu seinen eigenen diagnostischen Kategorien erhält, so hilft ihm das dabei, eine gute Beziehung zum Klienten aufzubauen und dessen Einzigartigkeit, Individualität und Besonderheit zu respektieren. Im Folgenden möchte ich mich den Diagnosekategorien widmen, die in diesem Konzept häufig angewendet werden:
•die Aufmerksamkeit des Klienten
•das Verarbeiten von Ereignissen
•die Trancelogik
•Kategorien mit Bezug zum sozialen Funktionieren
•die Position in der Herkunftsfamilie
•das bevorzugte Wertesystem
•die Metapher in der Wahrnehmung des Klienten und des Therapeuten
2.2Die Aufmerksamkeit des Klienten
Die Aufmerksamkeit ist ein Prozess, der von intentionalem oder unbeabsichtigtem, von automatischem oder unbewusstem Charakter sein kann (Lichtenberg et al. 2010). Die Aspekte, die hier bezüglich der Diagnose besprochen werden, beziehen sich auf unfreiwillige Prozesse, derer sich eine Person normalerweise nicht bewusst ist.
Die Aufmerksamkeit lässt sich auf unterschiedlichen Ebenen beschreiben, die eine praktische Bedeutung für die durchgeführte Therapie haben, so etwa über ihre Ausrichtung: Ist die Aufmerksamkeit des Klienten nach innen oder nach außen gerichtet? Eine Person, deren Aufmerksamkeit hauptsächlich nach außen gerichtet ist, achtet mehr auf die Bedürfnisse und die Wertigkeit anderer Menschen, als auf ihre eigenen Bedürfnisse und hat nur geringen Kontakt zu sich selbst. Es fällt dieser Person schwer, ein Behandlungsziel zu formulieren, das sich auf die eigenen Bedürfnisse und Wünsche bezieht. Fragt man nach dem Grund für die Therapie, so bekommt man oft zu hören, eine nahestehende Person oder ein behandelnder Arzt hätten sie zu einer Therapie bewegt. Während der Sitzungen berichtet die Person eher über Menschen aus ihrem Umfeld als über sich selbst. Außerdem wird sie versuchen, Bedürfnisse und Denkweisen des Therapeuten herauszufinden, um gut dazustehen und den Zuhörenden zufriedenzustellen. Die folgende kurze Anekdote zeigt eine typische Szene. Hier geht es um ein Kind, dessen Aufmerksamkeit nach außen gerichtet ist:
Eine Mutter ruft ihren Sohn, der draußen im Hof spielt:
Читать дальше