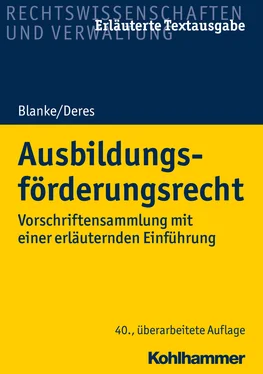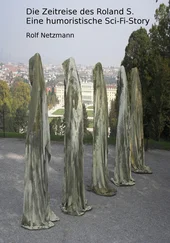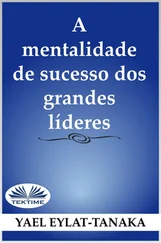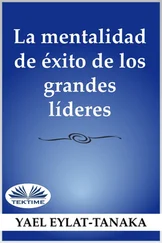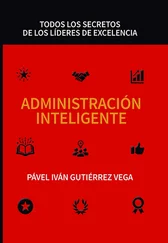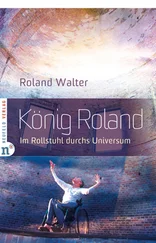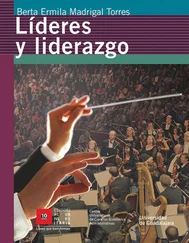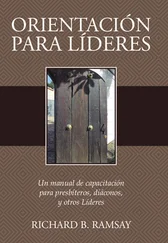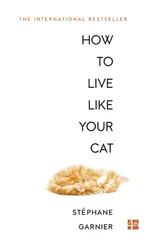| Übersicht |
| 1. |
Motive der Ausbildungsförderungsgesetzgebung des Bundes |
| 2. |
Entstehungsgeschichte und Weiterentwicklung des BAföG |
| 2.1 |
Entstehungsgeschichte |
| 2.2 |
Veränderungen von Grundregelungen |
| 2.3 |
Aktualisierung der Leistungsparameter 1974 bis 2008 |
| 2.4 |
Strukturdiskussion 1976–1978 |
| 2.5 |
Leistungsbegrenzung und -rückführung 1981/82 |
| 2.6 |
Basis weiterer Ausbildungsförderung gewonnen |
| 2.7 |
Weiterentwicklung und Reformarbeiten 1987–1990 |
| 2.8 |
Deutsche Einheit |
| 2.9 |
Novellierungen 1996, 1998 und 1999 |
| 2.10 |
AusbildungsförderungsreformG und 21. BAföGÄndG |
| 2.11 |
Die Legislaturperioden 15, 16 und 17 |
| 2.12 |
Legislaturperiode 18 |
| 2.13 |
Legislaturperiode 19 |
| 3. |
Überblick über die bundesrechtlichen Regelungen |
| 3.1 |
Förderungsbereich |
| 3.2 |
Förderung während einer Ausbildung im Ausland |
| 3.3 |
Freie Wahl der Ausbildung und der Ausbildungsstätte |
| 3.4 |
Förderung einer einzigen Ausbildung |
| 3.5 |
Personale Voraussetzungen (Staatsangehörigkeit/Alter) |
| 3.6 |
Eignung |
| 3.7 |
Familienabhängige Förderung |
| 3.8 |
Bedarfssätze |
| 3.9 |
Anrechnung von Einkommen und Vermögen |
| 3.10 |
Förderungsart |
| 3.11 |
Darlehensbedingungen und -rückzahlung |
| 3.12 |
Förderungsdauer |
| 3.13 |
Vorausleistung |
| 3.14 |
Ausführung des Gesetzes |
| 4. |
Überblick über Bildungskredit und Studienkredite |
| 4.1 |
Bildungskreditprogramm des Bundes |
| 4.2 |
Studienkredite |
| 5. |
Schülerförderung der Länder |
| 6. |
Leistungsbilanz der Bundesausbildungsförderung |
| 7. |
Die Bedeutung der Gesetzgebung auf dem Gebiet der individuellen Ausbildungsförderung |
1.Motive der Ausbildungsförderungsgesetzgebung des Bundes
Individuelle Förderung der Ausbildung durch die öffentliche Hand bedeutet: Der Staat stellt dem einzelnen Auszubildenden die für Lebensunterhalt und Ausbildung während der Ausbildungszeit benötigten finanziellen Mittel zur Verfügung. Diesen individuellen Unterhalts- und Ausbildungsbedarf zu decken, wurde herkömmlich als Aufgabe der Eltern und notfalls des Auszubildenden selbst angesehen. Der Staat beschränkte sich auf eine institutionelle Ausbildungsförderung, indem er die Ausbildungsstätten bereitstellte. Einer großen Zahl ausbildungsfähiger und -williger junger Menschen, deren Eltern nicht in der Lage waren, die hohen Aufwendungen während der oft vieljährigen Ausbildungszeit zu tragen, blieb damit eine gründliche, qualifizierende Ausbildung versagt.
Am Ende der 60er Jahre hielt dies keine der politischen Kräfte in Bund und Ländern mit dem Sozialstaatsprinzip des Art. 20 I des Grundgesetzes 1, einem Grundgedanken der staatlichen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland, für vereinbar. Der soziale Rechtsstaat, der – unter dem „Vorbehalt des Möglichen“ 2– soziale Unterschiede durch eine differenzierte Sozialordnung auszugleichen hat, wurde vielmehr als verpflichtet angesehen, durch Gewährung individueller Ausbildungsförderung auf eine berufliche Chancengerechtigkeit der jungen Menschen hinzuwirken. Er habe dem einzelnen die Ausbildung zu ermöglichen, die seiner Neigung, Eignung und Leistung entspreche und die er erhielte, wenn er und seine unmittelbaren Angehörigen in der Lage wären, die hierfür erforderlichen Mittel aufzuwenden.
Aber nicht nur um des persönlichen Schicksals des Einzelnen willen wurde zu diesem Zeitpunkt und wird heute noch viel drängender Ausbildungsförderung durch die öffentliche Hand als notwendig angesehen. Auch das Interesse der Allgemeinheit an der Heranbildung eines qualifizierten, den Anforderungen unserer hochindustrialisierten Gesellschaft auch zahlenmäßig genügenden Nachwuchses erforderte – und erfordert heute in noch viel stärkerem Maße – eine erweiterte staatliche Mitwirkung an der Aus- und Heranbildung. In den kommenden Jahrzehnten konnten aus damaliger Sicht und – hierfür besteht heute noch ein viel ausgeprägteres Bewusstsein – können die in Wirtschaft, Wissenschaft, Bildungswesen und Verwaltung unseres Landes erforderlichen Kräfte nur zur Verfügung stehen, wenn es gelingt, die sog. Bildungsreserven zu aktivieren. Aktuell kommt der individuellen Ausbildungsförderung im Hinblick auf die hohe Zahl von Jugendlichen mit Migrationshintergrund und die Notwendigkeit ihrer Integration eine zusätzliche Bedeutung, eine weitere Aufgabe zu.
Unabhängig von der aktuell erweiterten Aufgabenstellung der Ausbildungsförderung muss ihre Ausgestaltung an ihrer Grundaufgabe ausgerichtet bleiben: Realisierung des Sozialstaatsgebots des Grundgesetzes, allen jungen Bürgern – unabhängig von der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Situation ihrer Familie – eine intensive, veranlagungsgerechte, neigungsentsprechende Ausbildung an qualifizierten Ausbildungsstätten zugänglich zu machen.
2.Entstehungsgeschichte und Weiterentwicklung des BAföG 3
2.1Entstehungsgeschichte
Nachdem die vorstehenden Überlegungen in den fünfziger Jahren zunehmend stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit getreten waren, strebten die Bundesregierung sowie Abgeordnete aller Fraktionen des Deutschen Bundestages eine bundeseinheitliche Regelung der individuellen Ausbildungsförderung an. Diese Bemühungen sind zunächst daran gescheitert, dass dem Bund eine ausreichende Gesetzgebungskompetenz fehlte 4. Als im Zuge der von der Großen Koalition der Jahre 1966–1969 durchgeführten Finanzverfassungsreform die Einfügung einer entsprechenden Vorschrift in das Grundgesetz erreichbar erschien, erhielten die Vorarbeiten für ein Bundesgesetz neuen Auftrieb; jede der drei Bundestagsfraktionen legte einen eigenen Entwurf für ein Gesetz über Ausbildungsförderung vor. Nachdem der Bund durch das 22. Änderungsgesetz zum Grundgesetz (vom 12.5.1969, BGBl. I S. 363) Art. 74 Nr. 13 GG um die Gesetzgebungskompetenz für „die Regelung der Ausbildungsbeihilfen“ ergänzt hatte, verabschiedete der Bundestag bereits in der Plenarsitzung vom 26.6.1969 das „Erste Gesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Ausbildungsförderungsgesetz)“ (vom 19.9.1969 – BGBl. I S. 1719) 5, das am 1.7.1970 in Kraft trat. Die ursprüngliche Konzeption 6einer umfassenden gesetzlichen Regelung der Ausbildungsförderung in allen Ausbildungsbereichen – Schule, Betrieb, Hochschule – konnte allerdings nicht verwirklicht werden. Hierfür wären finanzielle Aufwendungen in einer Höhe erforderlich gewesen, wie sie nach der damaligen mehrjährigen Finanzplanung des Bundes nicht zur Verfügung standen. Daher beschränkte sich der Gesetzgeber im Laufe der Beratungen auf die bundeseinheitliche Regelung der Förderung des Besuchs weiterführender allgemein und berufsbildender Schulen; die in diesem Bereich bestehenden Förderungsmöglichkeiten waren sehr unbefriedigend und in besonderem Maße uneinheitlich.
Schon bei der Verabschiedung dieses Gesetzes forderte der Bundestag die Bundesregierung auf, bis zum 1. März 1970 den Entwurf eines umfassenden Ausbildungsförderungsgesetzes vorzulegen, durch das auch die Auszubildenden im Tertiären Bildungsbereich in eine bundeseinheitliche Förderungsregelung einbezogen würden 7. Nach den erforderlichen gründlichen Vorarbeiten konnte das Bundeskabinett am 27. Januar 1971 den Regierungsentwurf eines Bundesgesetzes über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz) verabschieden, der im Wesentlichen unverändert die Zustimmung der gesetzgebenden Körperschaften des Bundes, zuletzt am 23. Juli 1971 nach Anrufung des Vermittlungsausschusses auch des Bundesrates, fand. Das Bundesausbildungsförderungsgesetz vom 26.8.1971 (BGBl. I S. 1409) ist am 1.9.1971, dem Tag nach seiner Verkündung, in Kraft getreten. Der Gesetzgeber hat sich damals für das Modell der sozial-modifizierten Staatsfinanzierung entschieden, d. h., die Mittel für die Ausbildungsförderung werden aus allgemeinen Steuermitteln aufgebracht, die Leistungen fließen nur den Auszubildenden zu, die für die Durchführung ihrer Ausbildung darauf angewiesen sind.
Читать дальше