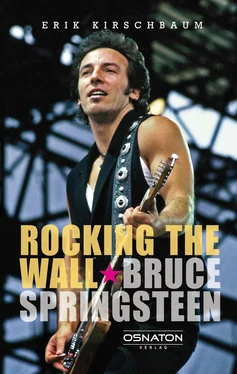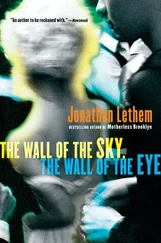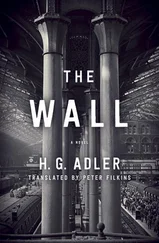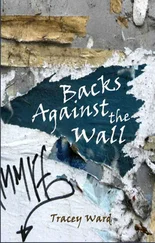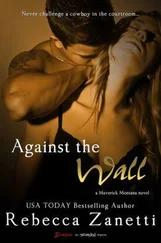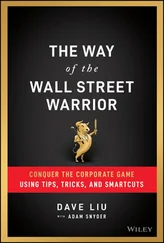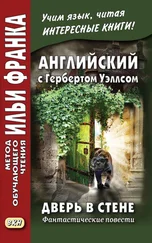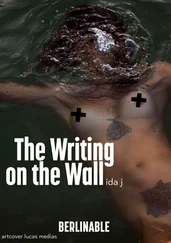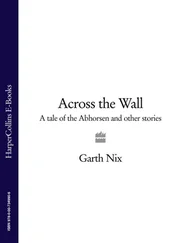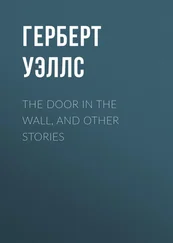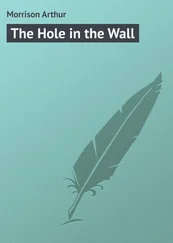„Wir riefen an und die Antwort kam sofort. Es war wie: ‚Ja, kommt rüber.’“
Dass sich der Eiserne Vorhang so rasch für Springsteen öffnete, war ein weiteres Indiz dafür, wie weit der Wandel in den Staaten des Ostblocks bereits gediehen war. Das war die Zeit der Entspannung, als Michail Gorbatschow Glasnost und Perestroika ausrief, und damit sanken auch die Hürden für westliche Musiker, im Osten aufzutreten. Hinzu kam, dass die Machthaber in Ostberlin sich sehr wohl bewusst waren, dass sich vor allem junge Leute immer mehr von den Idealen des „real existierenden Sozialismus“ abwandten und sich die Unzufriedenheit rasch zu Protesten auswachsen könnte. Ein kleines Ventil schien durchaus im Eigeninteresse der DDR-Elite zu liegen, selbst wenn man in Ostberlin gegenüber Reformen deutlich reservierter als beispielsweise in Ungarn oder – unter Gorbatschow – selbst in der Sowjetunion war.
Born to Run
Springsteens Wunsch, in Ostberlin zu spielen, reichte bis 1981 zurück. Damals, im April, war er von Westberlin aus mit einem Tagesvisum als einfacher Tourist in den Ostteil der Stadt gekommen. Wie viele Amerikaner faszinierten auch ihn die Geschichte der deutschen Teilung und insbesondere das Leben in der seit dem Bau der Mauer 1961 nicht nur politisch, sondern auch faktisch geteilten Stadt. Dabei war es nicht die „große Politik“, für die er sich interessierte. Ihn fesselten die Geschichten aus dem Alltag der Menschen diesseits und jenseits des Eisernen Vorhangs, Geschichten von Trennungen und Flucht, aber auch weniger dramatische Erzählungen von den Mühen und auch Freuden des Alltags in der DDR. Schon bei seinem kurzen Ausflug 1981 hätte Springsteen gerne die Chance ergriffen und ein Konzert im Osten der Stadt gegeben. Doch zu dieser Zeit war der Kalte Krieg besonders frostig – erst wenige Monate zuvor war Ronald Reagan als 40. US-Präsident vereidigt worden und im Osten Deutschlands hatten Erich Honecker und seine nicht weniger ideologisch festgefahrenen Vertrauten die Fäden in der Hand. Wohl nichts hätte die ostdeutschen Behörden bewegen können, einen amerikanischen Rockstar auftreten zu lassen, möge dieser sich auch noch so kritisch mit den Schattenseiten des Lebens in den USA auseinandersetzen.
In den Jahren vor der Öffnungspolitik des KPdSU-Generalsekretärs Michail Gorbatschow hatte die Moskauer Führung die Staaten des Ostblocks, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs unter sowjetische Besatzung geraten waren, in ihrem eisernen Griff. Seit 1968 galt die so genannte Breschnew-Doktrin, benannt nach dem damaligen Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Leonid Breschnew. Die Hinwendung eines sozialistischen Staates zum Kapitalismus galt der Doktrin zufolge als Gefährdung aller sozialistischen Staaten. Die Breschnew-Doktrin bildete die ideologische Grundlage für den sowjetischen Einmarsch in der Tschechoslowakei im Jahr 1968, bei dem russische Panzer zaghafte Bemühungen um einen „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“ im Prager Frühling niederschlugen.
Aber auch zuvor hatte es bereits ein ähnlich hartes Vorgehen von russischer Seite gegeben. Erhebungen in den baltischen Staaten wurden niedergeschlagen und Aufständler nach Sibirien verschleppt. Der Volksaufstand in der DDR 1953 sowie eine Rebellion in Ungarn drei Jahre später wurden ebenfalls brutal unterdrückt, aus Furcht vor einem Übergreifen der Proteste auf weitere sozialistische Staaten. Die Breschnew-Doktrin wurde nur Wochen vor dem Fall der Mauer durch die so genannte „Sinatra-Doktrin“ ersetzt, die den einzelnen Ländern im kommunistischen Lager erheblich mehr Freiraum im Umgang mit Protesten, aber auch bei wirtschaftlichen Reformen gewährte. Den Namen bekam sie in Anlehnung an Frank Sinatras Song My Way . Es war ein Meilenstein auf dem Weg der Sowjetunion, die Staaten Osteuropas aus der Umklammerung zu entlassen und ihnen eigene Wege in die Zukunft zuzubilligen.
In der DDR verstanden die Machthaber – anders als in vielen anderen Ländern – die neu zugebilligte Freiheit weniger als Ermunterung, der Reformfreude und Experimentierlust eines Michail Gorbatschows zu folgen, als vielmehr als Erlaubnis, alles beim Alten zu lassen. „Wenn der Nachbar sein Haus renoviert, heißt das noch lange nicht, wir müssten auch unsere Zimmer tapezieren.“ Dieser Ausspruch Erich Honeckers noch 1989 ist zum Sinnbild der Verbohrtheit der alten SED-Herrschaft geworden. Zum Ende der 80er-Jahre war die DDR ein Land, das sich an Hartleibigkeit und Reformunwillen innerhalb des sozialistischen Lagers nur noch mit Staaten wie Kuba oder Rumänien messen konnte.
Von Freiheiten, derer sich die Bürger etwa der Tschechoslowakei, Polens oder Ungarns verstärkt erfreuen konnten, war in der DDR unter Honecker nicht viel zu spüren: An der innerdeutschen Grenze wurde weiter auf Flüchtlinge geschossen, die versuchten, in den Westen zu fliehen, und der DDR-Staatssicherheitsapparat bespitzelte und infiltrierte eifrig alle Bestrebungen, die auch nur nach Opposition rochen. Und auch die hoffnungslos hinter dem Westen Deutschlands hinterherhinkende wirtschaftliche Entwicklung mit den entsprechenden Mängeln bei der Versorgung der Bevölkerung trug dazu bei, dass viele – vor allem junge – Menschen frustriert waren und sich nach Veränderungen sehnten. Viele verfolgten mit einer Mischung aus Staunen, Begeisterung und Neid die Entwicklungen, die Gorbatschow in Gang gesetzt hatte – und von denen sie doch nur sehr beschränkt etwas in ihren eigenen Leben spüren konnten.
Mauerabschnitt der East Side Gallery an der Mühlenstraße
Foto: Erik Kischbaum
Springsteen war 1981, als er zum ersten Mal in die DDR reiste, zwar bereits eine internationale Berühmtheit, aber den Aufstieg zum Weltstar schaffte er erst drei Jahre später mit Born in the USA . In der Zeit seines ersten Ostberlin-Besuchs war der Sänger auf seiner ersten großen Europa-Tournee mit The River . Den Auftakt zu der Tour über 34 Stationen machte ein Konzert in Hamburg am 7. April. Es war ein voller Erfolg. Es gelang Springsteen und seiner Band, das als stoisch bekannte Hamburger Publikum nach nur kurzer Zeit in eine Menge begeistert tanzender und singender Rockfans zu verwandeln. Von dort aus machte er sich auf der Transitstrecke auf den knapp 300 Kilometer langen Weg nach Westberlin, wo er am 8. April im Internationalen Congress Centrum (ICC) auftrat, übrigens auch zum ersten Mal im Westteil der Stadt. Es war ein angenehm milder Mittwoch im Frühling mit Temperaturen von bereits 15 Grad.
Читать дальше