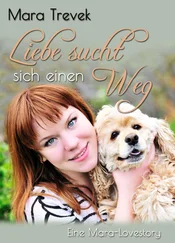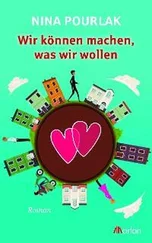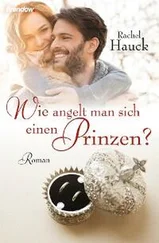In diesem Kapitel wurde ebenfalls aufgezeigt, dass man bei einer Beschäftigung mit der Graffitiszene unweigerlich zum Thema dieser Arbeit – den Graffitinamen – gelangt. Viele Sinnschemata der Szene sind eng mit dem Namen verknüpft. So ist Style ein wichtiger Szeneterminus – und gestylt wird der Name. Darüber hinaus zielt das Writing auf Bekanntheit ab – und dies erfolgt über das Anbringen des Namens. Das szenetypische Vokabular orientiert sich wie selbstverständlich an Größe, Position und Gestaltung der Werke, weil inhaltliche Differenzierungen für die Szene viel weniger relevant sind: Gesprüht wird der Name. In den nächsten Kapiteln richtet sich der Blick folgerichtig auf die Namen.
Wenn es um Namen geht, wird als Erstes an den eigenen Ruf- und Familiennamen gedacht. Zu diesen hat man in der Regel eine besonders enge persönliche Verbindung (DEBUS 2012: 11f.). Dass wir jedoch in unserem direkten räumlichen Umfeld mit einer Fülle an weiteren Namen konfrontiert sind, hat bereits der imaginäre Streifzug durch die onymische Landschaft einer Stadt in der Einleitung gezeigt – wobei es dabei lediglich um die sichtbaren, d.h. die schriftförmigen Namen ging. Tatsächlich sind noch weitaus mehr Objekte im alltagsweltlichen Lebensraum benannt. Bei dieser großen Bedeutung von Namen für den Menschen scheint es nur natürlich, dass Menschen bereits seit der Antike Überlegungen zum „Wesen“ der Namen anstellen.
HOUGH schreibt in der Einleitung des „Oxford Handbook of Names and Naming“, dass die Onomastik eine junge und alte Disziplin zugleich ist (2016a: 1). Diese Äußerung klingt zwar paradox, trifft aber auf die Entwicklung der Namenforschung durchaus zu. Denn es handelt sich einerseits um eine sehr alte Disziplin, weil sich etwa schon die antiken griechischen Philosophen wie Platon, Aristoteles und Sokrates mit der Referenzweise von Namen beschäftigt haben (HOUGH 2016a: 1). Die Namenforschung ist andererseits aber auch eine junge Disziplin, weil viele Aspekte (z.B. die eigene Grammatik der Namen) und Namenarten (z.B. Tiernamen, Warennamen und Pseudonyme) erst in den letzten Jahrzehnten in den Blick gerieten.
Das folgende Kapitel bietet eine Zusammenfassung und Diskussion der wichtigen onomastischen Theorien und Ergebnisse, die alle auf die eine oder andere Weise für die Beschäftigung mit Graffitinamen relevant sind. Dabei handelt es sich sowohl um ältere als auch um jüngere Erkenntnisse der Namenforschung. Einige der Grundlagen, z.B. die unterschiedliche Referenzweise von Name und Appellativ und die Frage nach der Semantik der Eigennamen, werden schon seit Jahrhunderten kontrovers diskutiert.1 Im anschließenden Kapitel zu den Pseudonymen geht es hingegen insbesondere um die Erkenntnisse der jüngeren Onomastik, denn die linguistisch ausgerichtete Beschäftigung mit Pseudonymen hat erst in jüngerer Zeit eingesetzt.
3.1. Positionierung im System der Sprache
Namen sind sprachliche Zeichen: Sie setzen sich in alphabetischen Schriftsystemen aus Buchstaben zusammen, können geschrieben und gesprochen werden, können wie andere lexikalische Elemente aus anderen Sprachen entlehnt sein und unterliegen den Regeln der syntaktischen Verknüpfung (FLEISCHER 1992: 45).1 Im System der Wortarten gehören sie zu den Substantiven. NÜBLING ET AL. verorten sie zudem unter den Konkreta, wo sie in direkter Nachbarschaft zu den Appellativen (z.B. Tisch, Auto, Haus), Stoffbezeichnungen (z.B. Wasser, Holz, Öl) und Kollektiva (z.B. Familie, Herde, Adel) stehen (2015: 28).2 In DUDEN – „Die Grammatik“ wird jedoch darauf hingewiesen, dass es „nicht angemessen [ist], Eigennamen als eine Unterklasse der Konkreta zu betrachten“, weil auch Nichtgegenständliches, z.B. geschichtliche Ereignisse (der schwarze Freitag), benannt werden (2016: 150). Auch Namen für Naturphänomene wie Hochdruckgebiete oder tropische Wirbelstürme lassen sich kaum als Konkreta fassen. Allerdings lässt sich sagen, dass mit den Personennamen, Tiernamen, Ortsnamen und Objektnamen sicherlich der Großteil der Namen auf konkrete Objekte verweist.
Namen weisen gegenüber den anderen Unterklassen der Substantive funktionale – und häufig auch formale – Besonderheiten auf.3 Insbesondere ihre Referenzleistung unterscheidet sie von den anderen Substantiven. NÜBLING ET AL. bezeichnen Namen daher auch als „ Luxuskategorien “, weil sie – anders als Appellative, Kollektiva und Stoffbezeichnungen – „eine exklusive 1:1-Beziehung zwischen einem Ausdruck und einem Objekt herstellen“ (2015: 22, Hervorh. i.O.). Dieser Luxus erfordert vom Sprecher allerdings einen hohen kognitiven Aufwand: Die Verbindung zwischen dem Namen und dem Objekt muss bekannt sein. Wie WIPPICH in Bezug auf Personennamen erläutert, besteht die Kompetenzbelastung dabei weniger im Abspeichern des Namens, sondern vielmehr in der „Verknüpfung des Namen[s] mit anderen Merkmalen der Zielperson, wobei vor allem sensorische Informationen (über das Aussehen, die Stimme etc.) und semantische Informationen (Beruf, Herkunft etc.) relevant sind“ (1995: 490).
Die Verknüpfungen von Namen zu Objekten werden ein Leben lang gelernt, womit sich Namen konträr zu anderen Wortarten verhalten, deren Erwerb ab einem gewissen Alter nahezu abgeschlossen ist (NÜBLING ET AL. 2015: 12). Weil das menschliche Gedächtnis über begrenzte Kapazitäten verfügt, können allerdings nicht unendlich viele Name-Objekt-Verknüpfungen gespeichert werden. Somit können nicht alle Gegenstände einen Namen erhalten. Benannt werden daher nur ausgewählte Objekte wie etwa Menschen, Siedlungen und Länder. Bei anderen Objekten ist entscheidend, wie häufig auf sie referiert wird, ob sich die Namenvergabe also lohnt (WERNER 1995: 477). So werden Tiere nur unter bestimmten Bedingungen benannt, wenn sie beispielsweise als Haustiere in enger Beziehung zum Menschen leben.4 Auch bei Mauern oder Felsen ist ihre Relevanz für den Menschen ausschlaggebend dafür, ob sie benannt werden oder nicht. Auf Tiere wie Bienen, die nicht benannt werden, wird stattdessen mit anderen Verfahren referiert, z.B. mit deiktischen Ausdrücken oder definiten Beschreibungen (WERNER 1995: 477).
Namen werden in vielen Publikationen in Kontrast zu den Appellativen beschrieben.5 Dies ist sinnvoll, weil im System einer Sprache „die sprachlich relevanten Eigenschaften und der Stellenwert sprachlicher Elemente nur bestimmt werden können, wenn ihre Beziehungen zu den anderen Elementen des Systems betrachtet werden“ (LINKE ET AL. 2004: 36). Die Beziehung zu den Appellativen ist für eine Betrachtung von Namen besonders relevant, weil sie der gleichen Wortart angehören und ebenfalls auf Objekte referieren. Die „Verwandtschaft“ ergibt sich auch dadurch, dass Namen diachron betrachtet mehrheitlich aus Appellativen hervorgegangen sind (NÜBLING ET AL. 2015: 31).6 Gleichzeitig eignet sich die kontrastive Betrachtung der Namen, um funktionale und formale Unterschiede zu den Appellativen herauszustellen, weshalb diese Vorgehensweise auch in dieser Arbeit gewählt wird.
3.2 Die Funktionen der Namen
3.2.1 Mono- und Direktreferenz
Nouns refer to concepts. […] Names refer to objects. (GÄRDENFORS 2014: 132)
In der onomastischen Literatur werden verschiedene Funktionen von Namen genannt, wobei je nach Namenklasse eine Funktion überwiegen kann, während eine andere in den Hintergrund tritt.1 Übereinstimmend wird für Namen jedoch eine besondere Referenzleistung angenommen, die in ihrem „sprachliche[n] Bezug auf nur ein Objekt, auf ein bestimmtes Mitglied einer Klasse“ besteht (NÜBLING ET AL. 2015: 17, Hervorh. i.O.). Auf diesen grundlegenden Funktionsunterschied bezieht sich auch das oben stehende Zitat von GÄRDENFORS (2014), das im Folgenden erläutert wird.
Appellative bieten im Sprachsystem die Möglichkeit, auf eine Gattung oder Klasse Bezug zu nehmen, d.h. auf eine Vielzahl von Objekten, Personen oder Sachverhalten, die ein Bündel gemeinsamer Eigenschaften aufweisen (DUDEN – „Die Grammatik“ 2016: 152). Diese Vorstellung gemeinsamer Eigenschaften bzw. gemeinsamer Merkmale stammt aus der strukturalistischen Semantiktheorie und basiert auf der Annahme, dass sich die Bedeutung von Wörtern oder Morphemen als Bündel semantischer Merkmale, quasi als Merkmalsliste, fassen lässt (GLÜCK UND RÖDEL 2016: 426). Ein Appellativ wie Frau nimmt demzufolge auf Objekte Bezug, die diejenigen Merkmale aufweisen, die im mentalen Lexikon unter Frau gespeichert sind. Darunter fallen etwa Merkmale wie [+ menschlich, + weiblich, + erwachsen].
Читать дальше