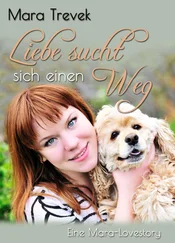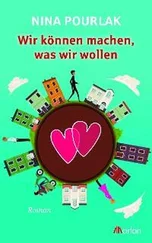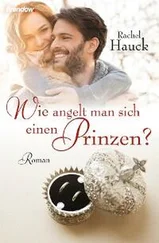Dabei wurde u.a. die besondere Bildlichkeit des Szenegraffitis herausgestellt, die – das ließ sich auch den Aussagen der Writer entnehmen – für die Graffitiwerke konstitutiv ist. Darüber hinaus wurde erläutert, dass es sich beim Graffitiwriting um eine Praktik handelt, da sich die Writer routiniert in bestimmten Räumen bewegen und dort bestimmte Handlungen ausführen, die in der Graffitiszene funktional und sinnhaft sind. Graffitis sind in dieser Perspektive Artefakte, deren Form (auch) durch die Gegebenheiten ihrer Herstellung bestimmt wird. So wirken sich beispielsweise die räumlich-situativen, physischen und sozialen Bedingungen der Praktik auf die visuelle Erscheinung der Graffitis aus.
Des Weiteren wurde hier dargestellt, dass Graffitis Formen von ortsfester, öffentlicher Schriftlichkeit sind, weil sie im öffentlichen Raum angebracht werden und für den Verbleib an ebendiesem Ort konzipiert sind. Beim Szenegraffiti besteht jedoch kein semantischer Bezug zum Ort: Sie können auch an anderen Orten positioniert werden, ohne dass sich dadurch ihr Sinn verändert. Allerdings ist es der Anbringungsort, der Graffitis überhaupt zu transgressiven Zeichen macht. Angebracht auf legalen Flächen sind Graffitis nicht transgressiv.
Als ortsfeste, öffentliche Schriftlichkeit, die typischerweise handschriftlich angebracht wird, gehört auch die Vergänglichkeit zu den Kennzeichen der Szenegraffitis. Sie verbleiben an ihrem Entstehungsort nicht dauerhaft und sind damit ein ephemeres Phänomen. Diese Vergänglichkeit versuchen die Writer dadurch zu kompensieren, dass sie ihre Werke fotografieren und im Internet präsentieren.1
2.2 Die geschichtliche Entwicklung des Graffitis
Eine Darstellung der geschichtlichen Entwicklung des Szenegraffitis ist für diese Arbeit relevant, da die Entstehung und die Weiterentwicklung der Graffitiszene zeigen, dass der Name schon immer im Mittelpunkt der Szeneaktivitäten stand. Der Graffitiname war bereits für die ersten amerikanischen Writer das zentrale Konzept und die deutschen Sprüher haben dies von ihren Vorbildern übernommen. Im Laufe der Jahre veränderte sich allerdings die Realisierung des Namens: Die Gestaltung der Schrift hat im Vergleich zu den Anfängen der Graffitikultur im Amerika der 60er- und 70er-Jahre ganz andere Dimensionen angenommen.
Es soll in einem ersten Schritt kurz darauf eingegangen werden, wie die geschichtliche Entwicklung des Graffitis zu beschreiben ist, wenn ein weites Begriffsverständnis von Graffiti zugrunde gelegt wird. Dies erscheint sinnvoll, weil sich dieses weite Begriffsverständnis, demzufolge Graffiti – gemäß der etymologischen Bedeutung von Graffito – Einritzungen bzw. Einschreibungen jeglicher Art bezeichnet, in vielen Publikationen findet.1 Es zeigt sich insbesondere in den Arbeiten der frühen Graffitiforschung (vgl. dazu NEUMANN 1986, GRASSKAMP 1982, HOFFMANN 1985, KREUZER 1986 und SKROTZKI 1999), wird aber auch noch in aktuelleren Publikationen zugrunde gelegt (vgl. dazu etwa NORTHOFF 2005, BEHFOROUZI 2006, BEYER 2012 und ACKER 2013).2 Deshalb wird diese Perspektive auf Graffitis im Folgenden kurz skizziert, wobei gleichzeitig erläutert wird, warum in dieser Arbeit von diesem weiten Begriffsverständnis Abstand genommen wird.
2.2.1 In- und Aufschriften seit der Steinzeit
Da das Beschriften und Bemalen von Flächen an frei zugänglichen Orten eine alte kulturelle Praktik darstellt, lässt sich Graffiti bei einem weiten Begriffsverständnis in eine lange Traditionslinie stellen. NORTHOFF formuliert sogar, „dass Graffiti[s] immer schon und kontinuierlich, wenn auch zu Zeiten unterschiedlich intensiv produziert wurden“ (2005: 14).1 Denn wenn Graffitis ganz allgemein als anonym angebrachte Schriften bzw. Bilder verstanden werden, können auch steinzeitliche Erzeugnisse wie Höhlen- und Felsmalereien, wie sie sich beispielsweise in Frankreich und Spanien finden, als „prähistorische Graffiti[s]“ gedeutet werden (KREUZER 1986: 428).
Auf die Wandkritzeleien aus der 79 n. Chr. verschütteten Stadt Pompeji wird ebenfalls häufig mit der Bezeichnung Graffiti referiert (z.B. bei BEYER 2012: 14, ACKER 2013: 8, BAIRD UND TAYLOR 2016: 18). Der Ausbruch des Vesuvs begrub die damals etwa 15000 Einwohner zählende Stadt unter einer Ascheschicht, wodurch heute eine Art Momentaufnahme römischer Lebensweise erhalten geblieben ist (BEYER 2012: 14). Durch die Ascheschicht wurden nicht nur die Gebäude und das Mobiliar konserviert, sondern auch Einschreibungen und Einritzungen an Hauswänden und Mauern. Insgesamt wurden in der Stadt etwa 15000 Inschriften und Zeichnungen aufgefunden (NORTHOFF 2005: 45). Die inhaltliche Bandbreite der Kritzeleien ist groß: Sie reicht von politischen Kommentaren, einer Art von Gesucht- und Gefunden-Notizen sowie Zitaten von Vergil und Ovid (WHITEHEAD 2004: 26) bis zu erotischen Aussagen und Liebesbekundungen (NORTHOFF 2005: 54). Auch Namen finden sich bereits unter den Wandbeschriftungen im antiken Pompeji.
Es ist anzunehmen, dass Pompeji nicht die einzige Stadt war, in der sich Bewohner und Reisende an den Wänden verewigten. Aus Schriften des Plinius geht hervor, dass Reisende regelmäßig Wände und Säulen des Heiligtums der Clitumnus-Quelle in Umbrien beschriftet haben sollen (BEYER 2012: 14). Auch anderen Dokumenten kann entnommen werden, dass öffentliche Gebäude wie Thermen, Tempel und Brücken beschrieben wurden (BEYER 2012: 14). NORTHOFF schlussfolgert, dass „[d]ie Wände antiker Häuser und Gassen […] ein verwirrend buntes Bild abgegeben haben“ müssen (2005: 61).
Auch im Mittelalter wurden schriftliche und bildliche Zeichen an öffentlichen Orten angebracht. Davon zeugen geritzte und gekratzte Namen, Initialen und Wappen von Reisenden und Pilgern des Spätmittelalters (KRAACK 2002: 51). Der Ulmer Dominikanerlesemeister Felix Fabri berichtet auf seiner Pilgerreise nach Jerusalem 1483 beispielsweise Folgendes über das Verhalten deutscher Adliger:
Ich habe etliche Adlige beobachtet, die sich zu solcher Narrheit verstiegen, daß sie in die Kapelle des Kalvarienbergs hinaufstiegen, sich auf den heiligen Felsen, in dem das Kreuzesloch ist, hinsinken ließen und sich den Anschein gaben, als beteten sie. Dann stützten sie die Arme auf und ritzten heimlich mit spitzen Gerätschaften Wappenschilde ein. […] Einige, die von derselben Dummheit getrieben waren, ritzten, alle Scheu und Gottesfurcht hintanstellend, in die Grabplatte über der allerheiligsten Beisetzungsstätte des Herrn mit Metallstiften ihre Namen und Wappenschilde ein, damit die Erinnerung an ihre eitle Unvernunft nicht getilgt werde […]. (FABRI 1996, [1843/49]: 120)
KRAACK zufolge zeigen diese Ritzereien, dass es den spätmittelalterlichen Reisenden „in erster Linie auf die Verewigung selbst und auf deren gute Rezipierbarkeit und nicht so sehr auf den sakralen und profanen Charakter des besuchten Ortes ankam“ (2002: 59). Interessanterweise ist es somit auch im Mittelalter der Name, der an öffentlichen Orten eingeritzt wird. Da im Mittelalter der Großteil der Bevölkerung aus Analphabeten bestand, kann allerdings davon ausgegangen werden, dass derartige Einritzungen nur von einigen wenigen Adeligen und Mönchen vorgenommen wurden.
Bei einem weiten Graffitiverständnis umfasst diese Bezeichnung auch politische Parolen und Bilder wie etwa den Slogan „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“, der um 1789 auf viele Kirchen- und Rathausfassaden angebracht wurde (STAHL 1989: 22). Auch aus dem 20. Jahrhundert ist die illegale Anbringung von Zeichen überliefert: An vermehrten Anbringungen des Hakenkreuzes vor 1933 in den Großstädten lässt sich etwa die Verbreitung der nationalsozialistischen Bewegung nachvollziehen. Das Hakenkreuz wurde bereits anonym im städtischen Raum angebracht, lange bevor es sich zum offiziellen Symbol entwickelte (STAHL 1989: 29).2
Читать дальше