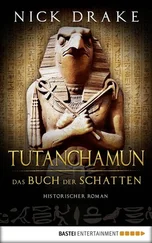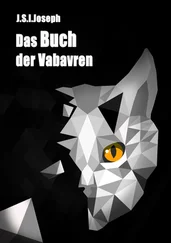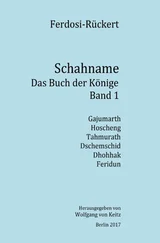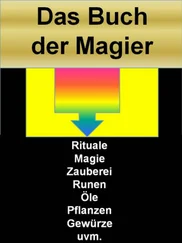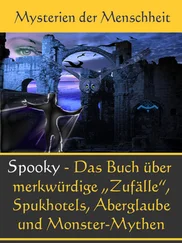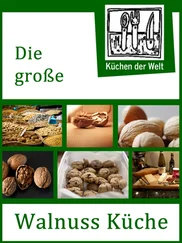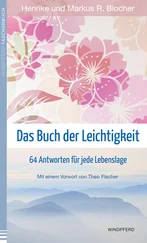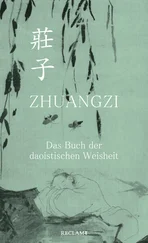AUTOR: Robert Louis Stevenson
TITEL: Die Schatzinsel
(aus dem Englischen von Heinrich Conrad)
ORIGINALFASSUNG: 1881
»Mit einem wilden Schrei griff John nach einem Baumast, riß die Krücke aus seiner Achselhöhle heraus und wirbelte das Wurfgeschoß durch die Luft. Es traf den armen Tom mit der Spitze mitten auf den Rücken zwischen die Schulterblätter. Seine Hände flogen in die Luft, er stöhnte kurz auf und fiel auf sein Gesicht.
Was für ein perfekter Bösewicht, was für ein archetypischer Pirat! Der Lange John Silver, oder Long John, wie er auch in der Übersetzung genannt wird, hat alle Schrullen, die man sich für einen sinistren Seemann so vorstellt, und wahrscheinlich ist er überhaupt der Grund dafür, dass man sich die Seeleute so vorstellt.
Da wären einmal die schiere Muskelkraft, die Holzkrücke und das fehlende Bein, der angeblich 200 Jahre alte Papagei auf der Schulter, der immer wieder »Piaster! Piaster!« krächzt, der im englischen Original ziemlich ausgeprägte Slang und das oft umständliche Philosophieren – hier haben wir einen Schurken, der seine Bösartigkeit keineswegs eingesteht, sondern immer politisch herumlaviert, um sein Handeln im Lichte der Gerechtigkeit darzustellen. Dass man ihn zum Kapitän gewählt habe, nachdem Smollett »desertiert« sei, klingt auch besser als das hässliche Wort »Meuterei«, und »Glücksgentlemen« ist ein milder Euphemismus für »Pirat«.
Dank seiner rhetorischen Fähigkeiten gelingt es John auch immer wieder, trotz seines furchterregenden Rufes – den sogar der legendäre Captain Flint fürchtete –, auf Schiffen anzuheuern, in diesem Fall als Koch des Expeditionsschiffs Hispaniola zur titelgebenden Schatzinsel, die er längst kennt, weil er dabei war, als der Schatz dort vergraben wurde. Ein Teil der Männer schließt sich ihm bereitwillig an, weil er ihnen ein gutes Gefühl gibt: John Silver, der Populist.
Seine dunkle Seite kommt auch nur sehr zweckgebunden zum Vorschein. Zwischendurch aber führt der gnadenlose Räuber und Mörder ein geradezu bürgerliches Leben und mit seiner Frau eine Gastwirtschaft. Als Ich-Erzähler Jim ihn zum ersten Mal sieht, meint er: »(…) und ich glaubte zu wissen, wie ein Pirat aussähe – jedenfalls nach meiner Meinung ganz anders als dieser reinliche freundliche Schankwirt.« Dass Silver intelligenter ist als der gewöhnliche Matrose, zeigt sich auch daran, dass er mehr verträgt: Er trinkt gut und gerne, aber nie so maßlos, dass ihm der Rum den Verstand raubt.
Robert Louis Stevenson wollte eine reine Männergeschichte schreiben, mit einem genialischen Fiesling im Zentrum. Die Figur des Long John gelang ihm, indem er einen guten Freund (den Dichter William Ernest Henley) zum Vorbild nahm und all dessen positive Eigenschaften abzog. Das kam so gut an, dass Long John Silver seither ein Eigenleben entwickelt hat. In über 20 Verfilmungen (nicht immer eindeutig als Antagonist) und Popsongs wurde er porträtiert, und sogar eigene literarische Fortsetzungen und Spinoffs schrieb man ihm. In den USA ist sogar eine Fast-Food-Kette nach ihm benannt. ■
BEINAME: Der Lange
BERUFE: Schiffskoch, Wirt
FAMILIENSTAND: verheiratet
STÄRKE: Trinkfestigkeit, Rhetorik
SCHWÄCHE: Gier
ANZAHL DER BEINE: 
 INTELLIGENZ:
INTELLIGENZ: 



 FILMDARSTELLER: Orson Welles, Tobias Moretti
FILMDARSTELLER: Orson Welles, Tobias Moretti
AUTOR: Karl May
TITEL: Winnetou I–III
ORIGINALFASSUNG: 1893
» Goddam!«, schrie er erschrocken auf. »Das sind ja diese …«
Der Mörder hielt inne. Der Ausdruck des Schreckens wich aus seinem Gesicht und machte dem der Schadenfreude Platz. Er hatte unsere Lage erkannt, griff zu seinem Gewehr und richtete es auf uns. »Eure letzte Wasserfahrt, ihr Hunde!«, schrie er dabei.
Woher der Name kommt, ist unklar. Ein saint, ein Heiliger, ist dieser Mann jedenfalls nicht. Gegen Ende von Winnetou I hat er Vater und Schwester des Titelhelden ermordet und dadurch vor allem die große, frisch aufknospende Liebe des zartfühlenden Alleskönners Old Shatterhand im Keime erstickt; als Einziger aus einer vierköpfigen Räuberbande vermochte er zu fliehen. Da versucht Old Shatterhand, einem von Santers angeschossenen Kumpanen Informationen über den neuen Antagonisten zu entlocken. Woher er komme? »Weiß – es – nicht.« Was er eigentlich sei? »Weiß auch nicht.« Wohin er wolle? »Hin, wo Gold – Beute.«
So einfach ist das, sich einen Erzfeind zu zimmern, der eine gerade begonnene Geschichte knapp vor ihrem friedlichen Abebben zur Trilogie ausbaufähig macht. Wir wissen nichts über ihn, außer dass er goldgierig ist. Aber er hat zwei herzensgute Menschen umgebracht, und da wir ebenfalls herzensgut, aber auch rachsüchtig sind, müssen wir den Mann jetzt weitere zwei Bücher hindurch jagen. Zugegeben, es geht dann in Winnetou II und III hauptsächlich um ganz andere Dinge, und Santer guckt immer wieder mit einem vom Goldrausch leicht erschöpften Wildwestverbrecherblick um die Ecke. Dann aber stiehlt er (typischerweise auch in den deutschlandweit großzügig gesäten Winnetou-Festspielen) allen anderen die Show und holt sich den Bösenbonus des Publikumslieblings ab (siehe auch Mario Adorf in den Filmen).
Als »einfacher, armer Cowboy« stellt sich Santer bei seinem ersten Auftritt vor, gleich einmal Antipathie bei Old Shatterhand erweckend. Das Gefühl wird wie immer bestätigt, als Santer Nscho-tschi und Intschu-tschuna erschießt, weil er denkt, die Apachen hätten goldene Nuggets bei sich. Santer entkommt der ewigen Rache der Blutsbrüder und findet bei den Kiowa-Indianern Unterschlupf.
In Winnetou II erdreistet er sich, seine Nemesisse (sagt man das so?) gefangen zu nehmen, und nur durch eine Verkettung sehr eigenartiger Umstände kommt dabei niemand ums Leben und sogar jeder einzelne frei. Am Nugget-tsil schließlich, dem Eldorado der Gierigen, findet Santer in Teil III von Winnetou dessen Testament und sein eigenes ironisches Ende: Beim Stehlen des Goldes detoniert ein von Winnetou noch zu dessen Lebzeiten platzierter Sprengsatz.
Aber es geht natürlich noch weiter. Denn obwohl die Hauptfigur tot ist, gibt es noch einen IV. Teil, in dem die finstere Seite Santers plötzlich auf krasse Weise in die Tiefe geht. Da wird nämlich die Familie des Gauners beschrieben, deren Großteil depressiv veranlagt ist, sodass kaum ein Enkelkind das Alter von 16 Jahren erreicht hat. Puh! Starker Tobak. Die hoffnungsvolle Nachricht: Hariman F. und Sebulon L. Enters, Santers Söhne, sind am Leben und auf der netten Seite, denn sie wollen die Taten ihres Vaters wiedergutmachen. ■
WIRKLICHER NAME: »Hat – viele – viele Namen.« (vermutlich Enters)
HERKUNFT: »Weiß – es – nicht.«
Читать дальше
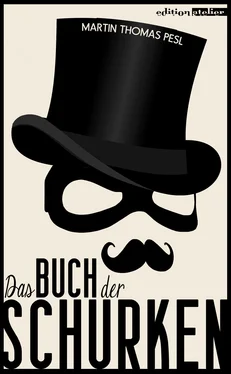

 INTELLIGENZ:
INTELLIGENZ: