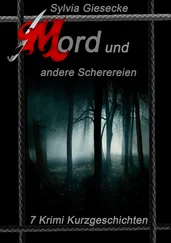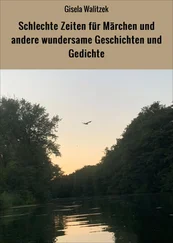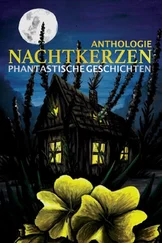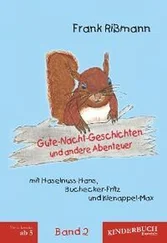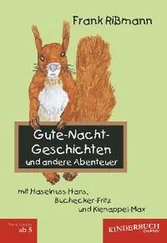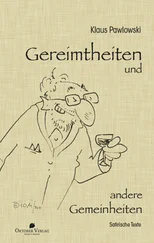Womit wir beim Kern der Sache wären, nämlich bei der Literatur, die jüngst ein anderer Schweizer Autor, Markus Werner, um den Roman Der ägyptische Heinrich bereichert hat, eine schöne, aber streckenweise auch ein wenig zähe Ägyptenlektüre. »Zäh« oder »harzig« aber sind Attribute, die auf Christoph Braendles kurzweilige, partienweise sogar durchaus komische Novelle am allerwenigsten zutreffen. Sein Unterschied zwischen einem Engel ist ein erstaunlicher Prosatext, ein sprachlich geschliffenes, vor (Selbst-) Ironie berstendes, mit Zitaten und literarischen Anspielungen gespicktes und dabei entspannt und unangestrengt daherkommendes kleines Meisterstück aus der Werkstatt eines der Welt mit Liebe zugewandten Literaten der stilistischen Extraklasse. Das heißt für den Leser: Ein gewisses Interesse für Ägypten wäre keine ganz schlechte Voraussetzung für die Braendle-Lektüre, und dennoch darf man sich auch ohne engere Beziehung zu Eseln, Kamelen und Wüstensand auf diese Novelle freuen. Aber der Reihe nach.
Der Protagonist heißt Paul und ist ein Esel, in gewisser Hinsicht jedenfalls. Weil das so ist, wird er von seinem Chef, dem Doktor Renner, zu einem Kongress nach Kairo geschickt – dort sollen sich die Eselsforscher treffen, die berühmtesten Asinologen der Welt. Und er, der Nicht-Akademiker Paul, er darf dabei sein. »Kairo. Wie das klingt. Und wie es nachklingt, lockt und verführt … Ich hab’ eine Arbeit, sagt er, eine gute, liebe Frau. Obwohl, denkt er, die Sehnsucht, denkt Paul … Zum Kollegen Simatovic sagt er, man kann in Wien leben und trotzdem Wünsche haben.« Zehn Tage soll die Reise währen, für Unterkunft ist gesorgt, und der flugscheue Paul wird mächtig nervös. Aber kaum ist er auf ägyptischem Boden, kommt er aus dem Staunen nicht mehr heraus. Kairo nimmt ihn gefangen. Seine Gastgeber erklären ihm die Stadt, in der ungefähr dreimal so viele Menschen leben wie in der gesamten Schweiz und in der der Wahnsinn das einzige Ordnungsmuster zu sein scheint, auf das Verlass ist. Und immer wieder taucht irgendein Esel auf, als schlecht behandeltes Alltagslasttier und zugleich als spätestens seit Bileam aus dem Buche Moses literarisch belastetes Dingsymbol. Prächtige Gebäude sind zu bestaunen, bemerkenswerte Kaffeehäuser ganz ohne Wiener Flair tun sich auf, Kamele kreuzen Pauls Wege, und dann die kleinen Hausboote auf dem imposanten Fluss – kurzum: Paul verliebt sich in seine neue Umgebung, der Rückflug wird auf unbestimmte Zeit verschoben, und Braendles romantisch gestimmter und dennoch ganz unsentimentaler Held zieht ins Gelobte Land, unterquert den Suezkanal, besucht das Katharinenkloster und besteigt den Berg Sinai. »Ich muss nur wissen, was der Unterschied zwischen einem Engel ist, denkt er im Traum, ich muss nur wissen, was der Unterschied zwischen einem Engel ist. Aber er kann sich beim besten Willen nicht erinnern.«
Der Erfinder dieses ungewöhnlichen Ägyptentouristen lässt kaum einen Topos der klassischen Reiseliteratur aus – aber er macht aus allen Topoi etwas, was Neues und Überraschendes zumeist. Etwa aus der schönen Vorstellung von der Wüste als einem Ort göttlicher Offenbarung zur Läuterung und Reinigung des inneren Menschen, die Uwe Lindemann kürzlich in einer umfangreichen Untersuchung näher erläutert hat (Die Wüste. Terra incognita – Erlebnis – Symbol. Eine Genealogie der abendländischen Wüstenvorstellungen in der Literatur von der Antike bis zur Gegenwart) . Paul begegnet in der Wüste sowohl Tod und Ewigkeit – und, damit einhergehend, der von den Ägyptern auch konkret vorgelebten Relativität von Zeit – als auch dem blühenden Leben, das in seinem Fall Anna heißt, voll Liebreiz ist und den rasch verliebten Reisenden unter anderem christliche Demut lehrt. Dass es in der Oase Baharyya ein Hotel Alpenblick geben soll und einen merkwürdigen Schweizer Geschäftsmann mit dem Lieblingsspruch »S’Glück isch es Vögeli« – das sind zwei kleine Beispiele für Braendles bisweilen skurrile Prosaversatzstücke, die immer ihren unabweisbaren Sinn für das Textganze haben und bei aller Komik niemals als lediglich witzige Dichtergags daherkommen.
Paul schließt sich einer deutschen Reisegruppe an, die eine Kamelreise ins mehrere Hundert Kilometer entfernte und nahe der libyschen Grenze liegende Siwa plant, und wie er sowohl seinem Kamel als auch der holden Anna näherkommt, das erzählt Braendle derart gekonnt, witzig, bezaubernd und ergreifend, dass es manchem Leser durchaus Tränen in die Augen treiben könnte: »Der Rücken eines Kamels ist großartig für die Seele, sagt er, und ganz grässlich für den Arsch. Hirschtalg hilft, rät Anna und meint, sie habe genug.« Die Zeit verliert langsam ihr Gesicht, Pauls allerwerteste Schmerzen werden allmählich unerträglich, und seine Glückserlebnisse an Annas Seite werden es in gewissem Sinne ebenfalls.
Von ganz unaufgeregt erzählten unerhörten Begebenheiten ist die Rede, krude Touristenwirklichkeit, religiös-spirituelle Erfahrungen und eine überbordende dichterische Fantasie vermischen und verweben sich, bis die Kamele schließlich den Jeeps weichen müssen. »Die Wüste hat uns hergegeben, sagt Paul, aber wer weiß, ob wir noch die Gleichen sind?« Ohne Anna in El-Alamein und Alexandria, übers Fernsehen konfrontiert mit dem balkanischen Kriegsgeschehen des letzten Jahres, und ohne Anna in Luxor und auf dem Nil: Paul, dem Zauber dieses einzigartigen Ägypten längst erlegen, bleibt ein Liebender, und um Frieden, Liebe und Glück kreisen die Gedanken und Empfindungen, die ihn umtreiben. Am Ende steht eine Vision, die Paul in einem Brief an Doktor Renner so formuliert: »Man muss mit dem Herzen denken, dachte ich, oder mit der Leber, dem Magen, mit der Milz … Und dann dachte ich mit dem Herzen; und ich begriff« – das Weltbild der Pharaonen nämlich. Der Brief – und damit fast die ganze Novelle – endet mit der schlüssigen, wenn auch vielleicht größenwahnsinnigen Frage: »Wird mir ewiges Wissen beschieden sein, während Sie, Renner, nicht einmal den Unterschied zwischen einem Engel erkennen?«
Was immer man von Engeln hält – Braendles Novelle ist keineswegs nur ein schmales Ägyptenbuch, das für eine Handvoll Orientfans von Interesse wäre und ins übliche Reiseliteraturregal gehörte. Hier ist kein eifrig protokollierender Reisereporter am Werk, und für die wohlfeilen Insidertipps und Freizeitinfos sind andere Bücher zuständig. Dass Christoph Braendle seine nüchtern romantische Liebeserklärung an Ägypten – und weit darüber hinaus: an den fragilen Zauber irdischen Daseins überhaupt – in der genannten Buchreihe veröffentlicht, ist für die Picus Lesereisen ein unschätzbarer Gewinn. Für den Autor mag darin auch eine Gefahr liegen – die nämlich, als eminenter Prosadichter und Stilist von hohen Graden weiterhin zu wenig bekannt zu sein und zu wenig geschätzt zu werden. Und das hat dieser Schweizer aus Wien nicht verdient, gerade nach diesem eindrucksvollen kleinen Buch nicht. Man sollte es lesen. Oder wenigstens verschenken. Oder beides.
Christoph Braendle: Liebe, Freud und schöner Tod. Wiener Sonaten. Wien 1998: Picus Verlag. 131 S.
Christoph Braendle: Der Unterschied zwischen einem Engel – Ägyptische Novelle. Wien 2000: Picus Verlag. 129 S.
Wer ist schon ein Held? Christoph Braendles Romanbiografie über Fritz Molden
Christoph Braendle ist ein ungewöhnlich vielseitiger Autor. Er schreibt Theaterstücke und Erzählungen, Essays und Reportagen, er verfasst auch glänzende Reiseprosa, und nun überrascht er seine Lesergemeinde mit einem längeren Text, der mit einem echten Leben und den Erinnerungen daran spielt und den er »Romanbiografie« nennt. Das ist per se ein mehr als heikles Genre. »Ich warne ausdrücklich davor, die in diesem Buch genannten Ereignisse unkritisch und ohne Überprüfung als Tatsachen zu werten«, schreibt der Autor denn auch in seinem kurzen Nachwort. Außerdem heißt der Mann, um den sich alles dreht, auch noch Fritz Molden, eine Institution weit über Wien hinaus und eine lebendige Legende nicht nur in Österreich. Als ob dies alles zusammen nicht schon genug wäre, trägt das Buch den Untertitel Ein österreichischer Held , ohne Fragezeichen wohlgemerkt, und auf seinen letzten fünf Seiten liest man nicht ohne Staunen »Anmerkungen von Fritz Molden zu Christoph Braendles Romanbiografie«. Diese Anmerkungen sollen, so möchte es der reale Fritz Molden, dem Leser »als Entscheidungshilfe im Wettstreit zwischen Biografie, romanhafter Fantasie, kritischer Meinung des Autors und meiner eigenen Wahrnehmung bzw. Überzeugung dienen«.
Читать дальше