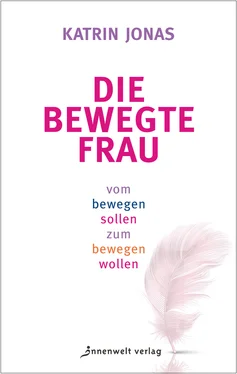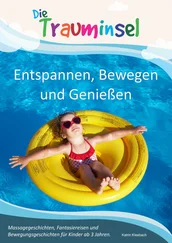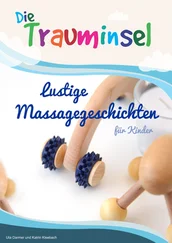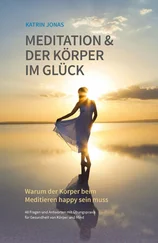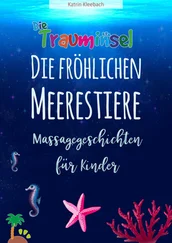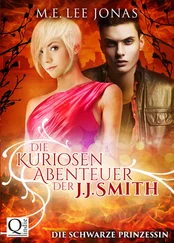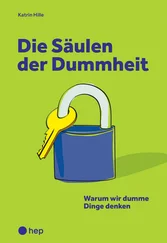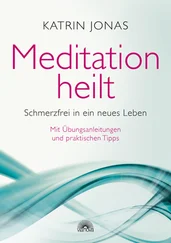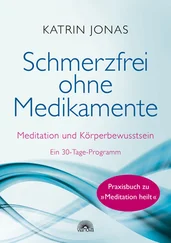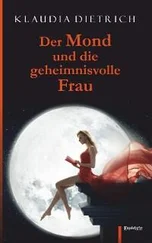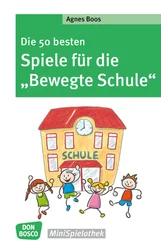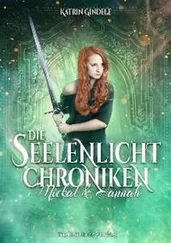Die Differenzierung zwischen Jungen und Mädchen beginnt nicht nur sehr früh, sondern hat auch sehr viele Gesichter. Beispielsweise werden Mädchen von früh an bereits anders gekleidet, also eher in Farben wie Rosa, Weiß und Creme, die schmutzempfindlicher sind und nicht zum Toben, Kriechen und Erkunden taugen. Oft tragen Mädchen helle Blusen, süße Kleidchen oder enge Jäckchen, in denen sie sich kaum bewegen, auf dem Boden wälzen und schon gar nicht wilde Räder schlagen können.
Da man meint, dass die Unterwäsche eines Mädchens nicht zu sehen sein sollte, Mädchen aber Röcke und Kleider tragen, werden Bewegungen, die genau diese Körperbereiche bloßlegen, schon einmal mit kritischem Blick beobachtet. Ja klar. Beim Purzelbäumeschlagen, Verkehrt-herum-an-der-Turnstange-Hängen oder Durchs-Gebüsch-Kriechen sieht man das Darunter. Außerdem wird zumeist auch weniger akzeptiert, dass ein Mädchen seine Knie aufschürft, seine Hosen zerreißt, Grasflecken im Rüschenkleidchen hat oder mit Löchern im Ärmel nach Hause kommt.
Außerdem werden die Haare oft „mädchenhaft“ frisiert, mit Schleifchen, hübschen Klemmchen und Spangen versehen. Diese sollen beim Bewegen natürlich nicht herausfallen oder in Unordnung geraten. Schließlich lernen Mädchen, auf ihre Frisur achtzugeben und sich aus wilderen oder bewegungsintensiveren Aktivitäten herauszuhalten.
Darüber hinaus kaufen nicht wenige Mütter ihren Töchtern mädchentypisches Schuhwerk wie Lackschuhe, enge Ballerinas mit Glitzersteinchen oder im Extremfall sogar Schuhe mit kleinen Absätzchen, in denen es sich nicht so ohne weiteres losrennen lässt.
Den meisten Eltern ist dabei nicht bewusst, dass sie das Bewegungsverhalten ihrer Tochter bereits mit der Wahl ihrer Bekleidung einschränken und ihr Verhältnis zum eigenen Körper auf Dauer prägen. Viele Mädchen schauen schon sehr früh sehnsüchtig ihren Brüdern oder Spielgefährten hinterher, wenn diesen ein freier, unlimitierter Bewegungsspielraum zugestanden wird.
Tatsächlich gibt es noch viele weitere Angriffsstellen, über die ein Mädchen von seinem natürlichen Bewegungsempfinden weggelotst wird.
Beispielsweise lernt ein Mädchen entsprechend der „Modelle“ und Vorbilder in seiner Umgebung sehr schnell, dass seine Aktionen oder die Art und Weise des Bewegens einer Bewertung unterliegt. Diese kann sein Bewegen entweder fördern oder aber mit einem Verbot, Sanktionen oder dem Einflößen von Angst durch eine übertriebene Vorsicht der Bezugspersonen versehen. Je nachdem, wie sehr es solche äußeren Maßgaben zu seiner Priorität macht, fallen seine motorischen Entscheidungen aus: In Abhängigkeit davon, wie bedeutsam die Beurteilungen von außen sind, wird es von seinem natürlichen Bewegungsempfinden weggelotst und in seiner authentischen Ausdrucksweise gestört. Es richtet sich immer mehr danach, wie sein Bewegen und Bewegtsein bei anderen ankommt, ob es willkommen, mit Kritik behaftet, störend oder verboten ist.
Von der Außenwelt dominiert
Und schließlich verändert es das Bewegungsverhalten entsprechend der äußeren Einflüsse rasant. Sein ureigenes Gespür passen viele Mädchen der Art und Weise an, die in ihrer Umgebung am meisten gewünscht sind. Zudem erwartet man von einem Mädchen mehr als von einem Jungen, dass es die Regeln seines Umfeldes erfüllt. Deshalb opfern nicht wenige Mädchen ihren natürlichen Bewegungsdrang zugunsten des Nicht-Auffallens oder Lieber-still-Bleibens.
Oder ganz anders: Sie geben ihr sicheres Gefühl für eine Bewegungs-Ruhe-Balance auf und verfallen in den Aktionismus oder die Hyperaktivität. Sie werden bereits früh zu kleinen „Macherinnen“, die sich um alles und jeden kümmern, unentwegt aktiv und versorgend sind, doch sich selbst dabei vergessen.
Und dann gibt es noch diejenigen Mädchen, für die die Erwachsenenwelt zu schnell und zu fordernd ist. Sie passen ihre Bewegungen einzig der Notwendigkeit an, irgendwie mitzuhalten und das Minimum der Erwartungen zu erfüllen. Und dabei büßen sie ebenfalls ihr natürliches Bewegungsempfinden ein.
„Restless Legs“
Ich erinnere mich an Lilly, eine Klientin, die unter einem sogenannten Restless-Leg-Syndrom, also an ständiger Unruhe in den Beinen litt und nicht für einen einzigen Moment still sitzen konnte.
Im Gespräch stellte sich heraus, dass sie ursprünglich ein sehr langsames Kind war, das Bewegung genoss, sich aber an die Geschwindigkeiten der Umgebung nie anpassen konnte. Ihre Grunderfahrung war, dass sie ständig den anderen hinterherrannte und es einfach nicht schaffte, mit ihnen Schritt zu halten. In ihrer Erinnerung blieb das grundsätzliche Gefühl, nie an die anderen anschließen zu können. Und dieses prägt noch immer ihr Leben. Als erwachsene Frau wird sie in wiederkehrenden Albträumen mit diesem Gefühl des Hinterherrennens konfrontiert, wobei sie den Anschluss immer knapp verfehlt. In ihrem Alltag setzt sie alles daran, schnell reagieren zu können und möglichst flink im Bewegen zu sein. Lilly führt ein atemloses Leben und ist immer in Eile. Als wir uns gegenübersitzen, holt sie kaum Luft. Sie kann ihren Körper kaum entspannen.
Ehrgeizige Erwachsenenwelt
Mitunter können Sie Anzeichen für solche Entwicklungen deutlich im Alltag sehen. Der Ehrgeiz nicht weniger Eltern besteht darin, dass ihr Kind möglichst früh das Laufen erlernt, anstatt abzuwarten, bis es sich wirklich sicher auf den Beinen fühlt. Noch bevor es in der Lage ist zu laufen, ziehen es die Eltern hinter sich her oder animieren es zum schnelleren Bewegen. Viele von ihnen glauben, dass ihre Kinder so früh wie möglich an die allgemeine Schnelligkeit der Erwachsenenwelt angepasst werden müssen. Deshalb lassen sie ihren Kindern kaum Zeit, ihr Leben in ihrem eigenen Rhythmus zu entdecken.
Darüber hinaus müssen sich Kinder, die früh in Betreuungseinrichtungen untergebracht werden, dem Gruppenzwang unterwerfen. Spielen und Bewegen ist dann angesagt, wenn es alle machen, und nicht, wenn der Körper es verlangt. Dabei kommen die Gruppendynamik, der Wettkampfgedanke und das Einander-Übertrumpfen ins Spiel. Besonders Mädchen kommen hier an Ihre Grenzen, denn häufig spielen Jungen die dominantere Rolle und drücken Gruppensituationen den Stempel auf.
Dies sind nur einige Beispiele, warum Kinder ihr ursprüngliches Gespür für Bewegung aufgeben, sich an eine fremde Bewegungsweise anpassen und für Angebote von Außen anfällig werden.
Und schließlich gibt es so früh bereits Extreme: Für einige Mädchen sind schon große Bewegungspläne in Form sportlicher oder künstlerischer Karrieren geplant, wenn sie noch nicht einmal fünf Jahre alt sind. Kinderballett, Kunstkurse oder Sportgruppen im Sinne von „Früh übt sich, wer eine Meisterin werden will“ sind typische Ausdrucksformen eines maskulinen, ergebnisorientierten Entwicklungsansatzes. Es geht immer früher ums Jemand-Werden, ums Leisten und Etwas-vorweisen-Können.
Besonders bei Mädchen wird das äußere Erscheinungsbild und wie sie beim Bewegen wirken mit jedem Lebensjahr wichtiger. Mädchen verinnerlichen das sehr schnell und richten sich auch bewegungsbezogen nach dem, was von ihnen erwartet wird. In Abhängigkeit von ihrem Umfeld werden sie bereits früh zu kleinen Prinzessinnen, süßen Kokettiererinnen oder niedlichen Ballerinas, die sich bereits sehr früh an einen künstlichen Selbstausdruck gewöhnen.
Legen wir hier eine kurze Pause ein. In dieser lade ich Sie zu einer neuen Selbsterfahrungssequenz ein.
Unter der Rubrik „ Beweg.Gründe “ finden Sie im Buch verschiedene Möglichkeiten zur Selbstreflexion. Wenn es für Sie attraktiv klingt, Ihr Verhältnis zum Thema Bewegung hier mit frischem Blick anzuschauen, haben Sie immer dann, wenn es um die Beweg.Gründe geht, die Chance, etwas genauer in sich hineinzuhorchen und sich mit Ihren Bewegungswahrheiten zu befassen. Was die praktische Ausführung anbelangt, gibt es drei Optionen:
Читать дальше