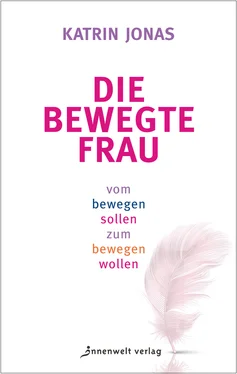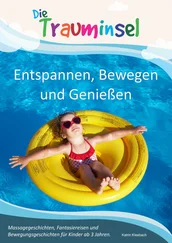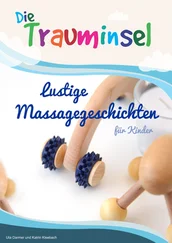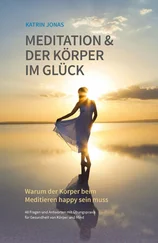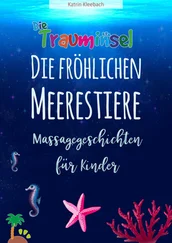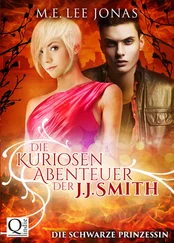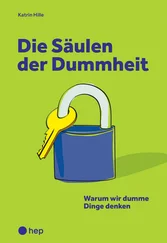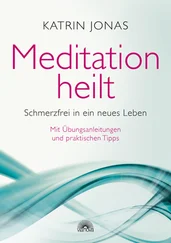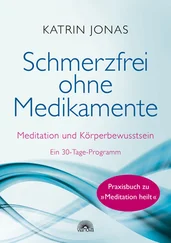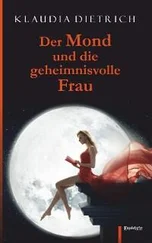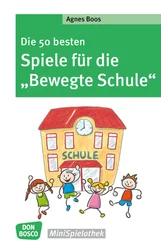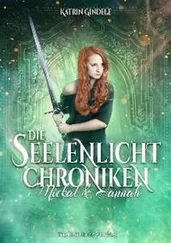Dabei lässt es sich von nichts anderem als seiner Sensorik leiten. Das ist so, weil das Kind nichts vom Leben versteht, keine eigenen Erfahrungen hat und sich an nichts anderem orientieren kann. Deshalb ist seine Sensibilität in den ersten Lebensmonaten enorm hoch. Und von dieser lässt es sich auch bewegungsbezogen leiten.
Schließlich kommt im Leben eines jeden Kindes irgendwann ein Moment, in dem es zum ersten Mal für seine bewegungsbezogenen Mühen sensorisch belohnt wird. Das passiert, sobald es seine Finger zum Mund führen kann, an ihnen lutscht und Wohlgefühl dabei empfindet. Später entdeckt es den großen Zeh und immer mehr Körperteile, die es zu benutzen lernt.
Während dieser Entdeckungen wiederholt es diejenigen Bewegungen besonders gern, die sich gut und flüssig anfühlen. Das kann das Drehen des Kopfes, das Wippen des Beckens oder das Kicken eines Beines sein. So entdeckt ein Kind in den ersten Wochen und Monaten immer mehr Körperteile, die ihm befriedigende sensorische Empfindungen vermitteln. Und diese regen es zum Weiterforschen an.
Sobald ein Baby die erste Anpassungsphase an seine Umwelt gemeistert hat, seine Sensorik ihm viel Genussvolles verspricht und sein Gehirn immer mehr reift, begibt es sich auf eine immense Abenteuerreise. Es bemerkt, welche Körperteile es bewegen kann und was dies auf sensorischer und motorischer Ebene bewirkt. Dabei erfährt es auch, dass es mit jeder neu entdeckten Bewegung einen größeren Handlungsspielraum erlangt, sich besser ausdrücken und verständlich machen kann.
Besonders begrüßt es diejenigen Momente, in denen es durch das Entdecken neuer Bewegungsfunktionen sein Gesichtsfeld erweitert. Das geschieht beispielsweise, wenn es lernt den Kopf zu heben, sich herumzudrehen und zu rollen. Und so geht es weiter. Irgendwann sitzt und krabbelt es, kann es die Schwerkraft überwinden und fühlt sich von der Vertikale angezogen. Eine bewegungsbezogene Revolution erlebt es, wenn es aufstehen und loslaufen kann. Was für ein Moment! Die Welt liegt ihm zu Füßen.
Diese im Kurzdurchlauf beschriebene Entwicklung basiert auf drei natürlichen Triebkräften, die uns Menschen zu eigen sind: dem „evolutionären Code“, dem sozialen Lernen und dem sensomotorischen Genuss.
1. Der „evolutionäre Code“
Der grundlegende Antrieb zu Bewegung resultiert daraus, dass wir Menschen ein bestimmtes „Set-up“, eine Grundinformation in uns tragen, die ich hier als den „evolutionären Code“ bezeichne. Das heißt, dass uns all unsere sensomotorischen Entdeckungen nicht vorgeführt oder beigebracht werden müssen. Das Kind macht diese entsprechend seiner Gehirnreife ganz von selbst, unabhängig davon, auf welchem Fleck der Erde es lebt, wie seine dortigen Bedingungen sind und ob seine Bezugspersonen es dazu animieren. Diese Grundinformation ist in jedem Menschen wach und wird in groben Zügen auch von den meisten Menschen durchlaufen.
2. Soziales Lernen
Die zweite Triebkraft besteht darin, dass das Kind mit zunehmender Reife seine Umgebung und die Menschen darin besser wahrnimmt und mit diesen in Kontakt treten möchte. Es erfährt, dass sich dieser Austausch immer produktiver und lebendiger gestaltet, je mehr Fähigkeiten des Bewegens und des bewegten Selbstausdrucks es entdeckt.
3. Sensomotorischer Genuss
Und die dritte Triebkraft ist, dass sich das Kind in seinem Vorgehen hauptsächlich vom sensomotorischen Genuss leiten lässt. Dadurch, dass es durch Bewegung eine immense innere Befriedigung erfährt, fühlt es sich stimuliert, nach mehr genussvollen Erfahrungen zu suchen. Und das ist einer seiner Hauptantriebe: Ein Kind folgt, so lange es gelassen wird, seinem inneren Erfülltsein.
Einmal abgesehen davon, dass die Interaktionen mit der Außenwelt ein Kind zum Bewegen animiert, sehen Sie deutlich, dass die Bewegungsentwicklung ein Prozess ist, den es zu großen Teilen selbstgeführt vollzieht. Und das, liebe Leserin, traf auch auf Sie zu. Auch Sie handelten vollkommen sicher aus Ihrem Eigenempfinden heraus und richteten sich nach Ihrem Wohlgefühl. Und jetzt staunen Sie vielleicht. Auch Sie orientierten sich an Ihrem Bewegungsgenuss.
Und da schauen wir noch etwas genauer hin. Weil sich ein Kind seiner Vorgehensweise nicht bewusst ist, sondern einfach intuitiv vorgeht und seinem Innenleben folgt, gestaltet sich dieser Prozess recht simpel: Bewegungen und Aktionen, die sich im Inneren produktiv, organisch und deshalb erfüllend anfühlen, verfolgt es weiter. Was es als gegenteilig, unbefriedigend oder unorganisch wahrnimmt, weckt nicht sein Interesse. Und genau diese Variablen sind beim Erlernen neuer Bewegungen seine stärksten Katalysatoren. Diejnigen Bewegungen, durch die es sensomotorische Erfüllung findet, untersucht es besonders genau, benutzt es öfter und feilt es aus. Lösungen findet es dort, wo es Bewegungsfülle, koordinativen Fluss und Genuss vermutet und schließlich erfährt.
Und genau diese Vorgehensweise sollten Sie sich, wenn Sie auf Ihre Beziehung zum Bewegen schauen, einmal auf der Zunge zergehen lassen! Indem wir Menschen Bewegung von klein auf mit sensomotorischer Befriedigung verbinden, liegt es nahe, dass uns dieselben Qualitäten auch weiterhin als innerer Leitfaden beim Bewegen dienen. Sie vermitteln uns, was für uns erfüllend, „richtig“ und natürlich ist.
Das Gefühl für Aktivität und Ruhe
Darüber hinaus hat ein Kind einen ausgeprägten Sinn für das Verhältnis zwischen Aktivität und Ruhe. Genauso, wie es sich enthusiastisch und ausgelassen bewegen kann, begibt es sich augenblicklich zur Ruhe, wenn es genug vom Aktivsein hat. Und umgekehrt: Wenn es sich ausgeruht hat, verlangt sein Bewegungsdrang wieder nach seinem Ausdruck und diesem folgt es dann auch.
Diese beiden Vorgänge – Aktivsein und Ruhen – wechseln einander ab und streben fortlaufend nach Balance. Weil das so ist, werden Sie weder ein Kind finden, das permanent in Aktivität verbleibt, noch eins, das in Passivität verharrt. Ein Kind ist mit seinem Körper so eng verbunden, dass es sich von seinen sich ständig wechselnden Bedürfnissen leiten lässt und diese immer wieder aktualisiert ins Gleichgewicht bringt.
So kommen wir zu einer weiteren Wahrheit: Es ist nicht ganz richtig, wenn man den Menschen zum steten und regelmäßigen Bewegen animieren möchte. Zutreffender müsste es heißen, dass der gefühlte Wechsel zwischen Bewegen und Ruhen zu unserer Natur gehört. Und dieser gibt dann auch den Ausschlag dafür, dass wir nicht in den Extremen landen, dass wir uns weder durch Überaktivität erschöpfen noch im Phlegmatismus versacken.
In der vergangenen Woche, als ich in London Heathrow auf den Flug nach Shanghai wartete, demonstrierte ein etwa dreijähriger asiatischer Junge genau das lebhaft. Nachdem er seine Mutter auf Trab gehalten hatte, weil ihn der Inhalt eines großen Abfallkübels fesselte, kam er nach einer Weile zu ihr zurück, zog sich die Kapuze seines Hoodies über den Kopf und legte sich neben sie auf die Bank. Auf der Stelle schlief er ein, und zwar so fest, dass die Mutter ihn nach dem Aufruf zum Boarding-Gate tragen musste.
Damit kommt noch eine weitere Eigenschaft ins Spiel: Das alles passiert, weil ein Kind im Moment lebt und sich in sein Bewegen total und passioniert hineinbegibt. Wenn es spielt, sich mit etwas eingehend befasst oder von einer neuen Entdeckung begeistert ist, taucht es voll und ganz in die jeweilige Aktion ein. Genau dieses Verbundensein mit dem Körper im Moment beinhaltet auch, dass es spürt, wann es genug von etwas hat und sein Organismus anderes braucht. Also hält es auf der Stelle an. Ein naturbelassendes Bewegungsverhalten ist spontan. Es entspricht der inneren Situation des Menschen und hat nichts mit äußeren Parametern zu tun. Ein Kind lässt sich intuitiv von seinem Bewegungs- oder Ruhebedürfnis leiten und erreicht in der Art, wie es das tut, aus Sicht der Natur echte „Perfektion“.
Читать дальше