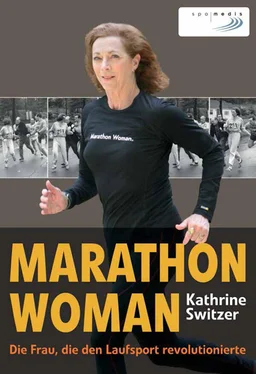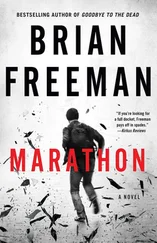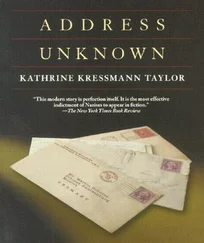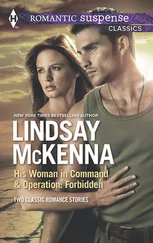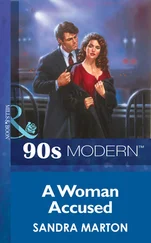Ich hatte gehofft, auf stärkere Feldhockeyspielerinnen zu treffen, um meine Technik zu verbessern. Aber wie sich herausstellte, war ich eine der besseren Spielerinnen. Es schmeichelte meinem Ego nicht, es war frustrierend. Als einige Spielerinnen nach einem Sprint außer Atem eine Pause machen mussten, war mir klar, dass wir nie ein erfolgreiches Team sein würden. Und als einige Abwehrspielerinnen darauf bestanden, ihren Longline-BH samt Hüfthalter zu tragen, wusste ich, dass es keine Hoffnung gab.
Das Spielfeld war ein Witz. Es war mit Steinen und Unkrauthügeln und kahlen Stellen übersät, der Ball rollte überall hin, nur nicht in die Richtung, in die er sollte. Ab und an errangen wir dennoch einen Heimsieg, weil niemand sonst auf diesem Feld spielen konnte. Die Mannschaften, die uns besuchten, besonders die aus den schicken Schulen, wie zum Beispiel Hollins, waren daran gewöhnt, auf traumhaften Anlagen zu spielen, die wie Golfplätze waren. Unser Platz brachte sie völlig durcheinander.
Eines Tages besuchte uns die legendäre Engländerin Constance Appleby, die Feldhockey im Jahr 1901 nach Amerika gebracht hatte, und hielt mit uns eine Trainingseinheit in Theorie und Praxis ab. Ich betete sie an und schätzte sie auf ungefähr achtzig Jahre. Man kann sich mein Erstaunen vorstellen, als ich herausfand, dass sie dreiundneunzig war. Sie wirkte nicht im Mindesten gebrechlich, war ziemlich kräftig um die Mitte herum und hatte sich mit einer schokoladenbraunen Tunika und farblich passender Schärpe und Schienbeinschützern angetan.
Nach einer kurzen Ansprache schockierte uns Miss Appleby, indem sie uns aufs Spielfeld jagte und mit uns spielte. Wir griffen gerade das Tor an, als Miss Appleby nicht weit von mir entfernt über einen großen Maulwurfshügel stolperte und lang hinschlug. Ich rannte zu ihr und schrie: »Oh, Miss Appleby, ist Ihnen etwas passiert? Oh, oh, oh!« O Gott, dachte ich, wir haben Miss Appleby umgebracht, aber als ich ihr aufhelfen wollte, sprang sie auf die Füße, wies mit ausgestrecktem Arm wie ein General auf das Spielfeld und rief mit ihrem unnachahmlichen britischen Akzent: »Weiterspielen!«
Von diesem Moment an wusste ich, dass ich Sport machen würde, um mein Leben lang in Form zu bleiben. Miss Appleby war eine fitte, lebhafte alte Schachtel, und so wollte ich im Alter auch sein. Das Problem war nur, dass Frauen keinen Mannschaftssport außerhalb der Universität treiben konnten, es sei denn, man wurde Trainerin und konnte auf diese Weise dabei sein. Ich wollte nicht Trainerin werden, und ich wollte nicht nur dabei sein. Ich wollte eine Sportlerin sein, aber auch mehr als das. Ich wollte einen Beruf haben, einen journalistischen Beruf. Ich wollte sein wie die griechischen Athleten, die auch Philosophen waren: Ich wollte herausgefordert werden und an der Herausforderung wachsen.
Ich hatte dies oft mit mir selbst diskutiert, meistens beim Laufen, was ich weiterhin fast täglich nach dem Hockeytraining machte. Laufen war unglaublich befriedigend, selbst wenn es nur um den Sportplatz herum ging oder hin und wieder in einer großen Schleife um den Campus. Die Strecken hielten sich in Grenzen, sie gaben mir das Gefühl, etwas zu schaffen, und es war eine angenehme Art, die Frustrationen des Trainings mit der Mannschaft abzubauen, bei dem ich kaum außer Atem geriet. Ich fürchtete, mit der Mannschaft meine Form zu verlieren – was für eine Ironie! –, und ich wusste, dass Laufen mich stark und selbstsicher machte, bis ich die Lösung gefunden hatte.
An einem herrlichen Nachmittag im Herbst spielten wir beim nahen Sweet Briar College. Noch nie hatte ich ein so gepflegtes Spielfeld gesehen, und entsprechend schnell war auch das Spiel. Unsere Mädchen waren nicht in Form, und die Spielerinnen von Sweet Briar hatten uns in der Hand. Unsere Hüfthalter tragende Verteidigerin ließ die Gegnerin vorbei, und lachte dabei auch noch. Da spurtete ich los, um ihre Position einzunehmen, und versuchte, ein Tor zu verhindern. Verärgert, weil ich sowohl ihre Arbeit als auch meine verrichten musste, schrie ich sie an: »Das ist nicht lustig. Renn ihr nach!« Und ich schwöre, sie blieb stehen, stemmte die Hände in die Hüften und sagte: »Das ist nur ein Spiel, Kathy.« (Spiel sprach sie wie »Spie-hiel« aus.)
Nach dem Spiel schien niemand in unserem Team etwas dabei zu finden, dass wir verloren hatten. Sie waren begeistert, mit den Sweet-Briar-Mädchen Tee zu trinken. Ich war so wütend, dass ich mich verkrümelte, die sanften Linien der Blue Ridge Mountains betrachtete und mich fragte, warum es für mich nicht nur ein »Spie-hiel« war, warum ich es wichtig fand. Die Trainerin kam zu mir und sagte: »Du verlierst nicht gern, stimmt’s?« Es war viel komplizierter als das, aber ich war nicht gewandt genug, um ihr zu erklären, wie mir zumute war. Ich konnte lediglich sagen: »Nein, ich verliere nicht gern«, aber ich fing immerhin an, mich zu fragen, ob ich das Zeug zur Mannschaftssportlerin hatte. Vielleicht brauchte ich einen individuellen Sport. Dann musste ich nur auf mich selbst wütend sein. In drei Jahren würde ich sowieso keinen Mannschaftssport mehr betreiben können, weil es damals keinen Mannschaftssport für Frauen gab.
Heute – vierzig Jahre später – träume ich manchmal, dass ich Feldhockey spiele. Dann habe ich die Schnelligkeit und die Ausdauer, die ich damals hatte, bin aber so erfahren und gewieft wie heute. Meine Mannschaftskolleginnen und ich arbeiten zusammen, wir bauen brillante Spiele und Spielzüge auf, die ich mir mit achtzehn nie hätte ausdenken können. Dann wache ich lachend auf und frage mich, wie anders mein Leben verlaufen wäre, wenn Feldhockey schon damals eine olympische Disziplin gewesen wäre.
Dave und ich hatten uns darauf geeinigt, im College auch mit anderen auszugehen, aber weiterhin fest zusammenzubleiben. Da er ein Erstsemester in der Marineakademie in Annapolis war, würden wir uns sowieso nur sechsmal im Jahr sehen können, warum sollten wir da nicht auch mit anderen ausgehen? Die wichtigsten Feierlichkeiten im College wurden June Week genannt, sie fanden am Ende des Ausbildungsjahres statt, und in der Akademie wurde jeden Abend getanzt. Meiner Mutter lag es besonders am Herzen, dass ich, ihre Tochter, daran teilnahm. Sie gab, was nicht oft vorkam, ihren weiblichen Fantasien Ausdruck, und ihre Geschenke zu Weihnachten in jenem Jahr bestanden aus Abendkleidern und allgemeinen Accessoires zur Gestaltung der June Week.
Das erste Weihnachten zu Hause in den Collegeferien war eine Entzauberung für mich, weil Dave sich so verändert hatte beziehungsweise weil die Marineakademie ihn verändert hatte. Er war nicht mehr der fröhliche Junge, den ich gekannt hatte, er kommandierte herum, sagte, ich müsse vom Lynchburg College zum Goucher College wechseln, um näher bei ihm und der Akademie zu sein, es sei egal, wo ich den Abschluss mache, ich würde sowieso nicht zu arbeiten brauchen. Darüber musste ich laut lachen, denn wir hatten unsere Berufswünsche in der Highschool besprochen.
»Wenn ich Marineoffizier bin, wird meine Frau nicht arbeiten«, eröffnete er mir.
»Aha«, sagte ich. »Und was soll ich in den sechs Monaten im Jahr machen, in denen du auf See bist?«
»Meine Mutter hat auch nicht gearbeitet, und sie war glücklich und zufrieden damit, für ein schönes Heim zu sorgen.«
»Nun, meine Mutter hat immer gearbeitet, und sie ist auch glücklich und zufrieden. Sie verdient ihr eigenes Geld, sie ist anerkannt in ihrem Beruf, und ich habe auch vor zu arbeiten, also mach dich darauf gefasst.«
Unsere strahlende Beziehung verdüsterte sich. Ich wollte immer noch zur June Week gehen – ich hatte schließlich diese schönen Abendkleider! –, aber ich war aus zwei weiteren Gründen von Dave immer weniger begeistert. Erstens lehnte er es plötzlich ab, dass ich lief, weil es mich in seinen Augen zur Außenseiterin machte. Das sagte er mir auf einer Party, und ich wurde so wütend, dass ich mich ohne ihn auf den sieben Meilen langen Heimweg machte. Es war spät, und ich wusste, dass es dumm von mir war. Als ein Freund im Auto vorbeikam und anbot, mich nach Hause zu fahren, willigte ich ein. Als ich eingestiegen war, merkte ich, dass ich mich geirrt hatte, der Mann war kein Freund, nicht mal ein Bekannter. Während der Fahrt dachte ich, o Gott, das ist sehr gefährlich! An einem Stoppschild sprang ich aus dem Wagen, rannte durch die Vorstadtgärten und versteckte mich unter einer Hecke. Dort lag ich eine Ewigkeit, und der Typ suchte nach mir. Als ich sein Auto wegfahren hörte und wusste, dass ich in Sicherheit war, ging ich zur Party zurück und bat einen Freund, mich nach Hause zu bringen. Dave kam später zu mir, wir stritten uns, weinten beide, und ich schrie ihn an, es sei verflucht gut, eine Läuferin zu sein, sonst hätte ich dem Verfolger nie entkommen können.
Читать дальше