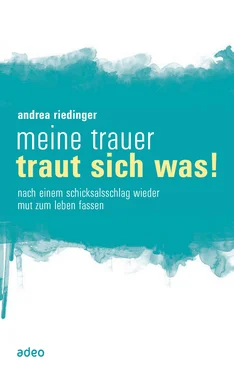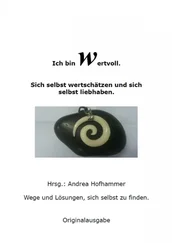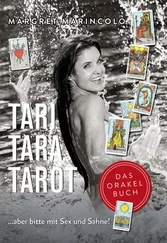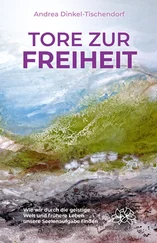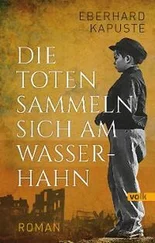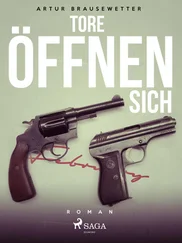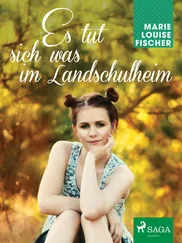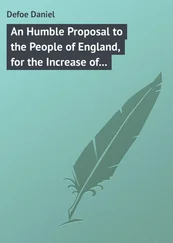Neben dem Befund liegt aufgeschlagen der Pschyrembel, ein klinisches Wörterbuch, die Informationsquelle der Medizin. Das Blatt mit der Diagnose sieht langsam aus wie im Fremdsprachenunterricht, bei dem man Vokabeln übersetzt. Denn zu jedem unbekannten lateinischen Fachbegriff schreibe ich mit Bleistift die Übersetzung und gehe dann zum nächsten weiter. „Proliferation“, Andi blättert angespannt im Lexikon, bis die gesuchte Definition gefunden ist. „Wucherung“, seine Antwort. So geht das. Wort für Wort. Satz für Satz. Wie bei einem Puzzle setzen wir Stückchen für Stückchen zusammen, bis sich ein Bild ergibt, das uns erschüttert.
In den ersten zwei Wochen nach dem Ausbruch von Andis Krankheit tappten wir, was die genaue Diagnose anging, ziemlich im Dunkeln. Es fanden zig Untersuchungen statt, doch wir bekamen keine klare Antwort. Diese Zeit war schrecklich und stark verunsichernd.
Raumforderung! Mit diesem Begriff konfrontierten uns die Ärzte in den ersten Tagen ohne weitere Erklärungen. Doch was soll einem das als Laie sagen? Nach langem Warten vermuteten sie Entzündungen im Gehirn, vielleicht eine beginnende Multiple Sklerose, doch auch bösartiges Gewebe, also Krebs, stand nach wie vor im Raum. Ich kann verstehen, dass Ärzte sich erst einmal ein genaues Bild verschaffen müssen, doch niemand hat meinem Mann, selbst auf Nachfrage, den genauen Hintergrund der einzelnen Untersuchungen oder Begrifflichkeiten erklärt. Das Internet war es, was uns beide aufklärte. Diese Erfahrung war für Andi und auch für mich prägend.
Auf jeden Fall sehe ich bei schweren Krankheiten den behandelnden Arzt oder auch den Hausarzt im Fokus. Wer nicht Medizin studiert hat, für den ist die Krankenhauswelt ein Buch mit sieben Siegeln. Jeder Patient tut sich schwer, Ergebnisse, Befunde und Aussagen einzuordnen. Doch mein Mann wurde allein in fünf verschiedenen Krankenhäusern behandelt. Den speziellen Arzt seines Vertrauens gab es nur phasenweise. Und selbst innerhalb eines Krankenhauses tauchten bei den Visiten immer wieder andere Ärzte auf: Chefärzte, Oberärzte, Assistenzärzte, Hämatologen, Onkologen, Radiologen, Strahlenexperten, Neurologen, Neurochirurgen und, und, und. Es gab keine Stelle, an der alle Fäden zusammenliefen. Darum mussten wir uns schon selber kümmern. Und das taten wir, denn damit hatten wir beide das Gefühl, wieder agieren zu können und uns nicht hilflos zurücklehnen zu müssen und abzuwarten, bis uns eine neue Lawine überrollt. Wir saugten Informationen auf wie ein Schwamm, sortierten und bündelten diese, behielten vor allem bei einem Krankenhauswechsel die Übersicht und konnten Fragen fast immer sofort beantworten. „Der mündige Patient“ kursiert als Schlagwort immer wieder in der Presse. Doch leider ist es gar nicht so einfach, aufgeklärt und eigenverantwortlich den Ärzten, eben den Spezialisten, gegenüberzutreten.
Wer es schafft, die Kraft und Mühe aufzubringen und sich über seine Lage zu informieren, der richtet den Fokus automatisch auf das eigentliche Problem, auf den Kern der Krise, auf die Realität. Und genau auf diese Weise besteht die Chance, der Ohnmacht und der Hilflosigkeit zu entkommen. In kleinen Schritten lösen wir uns von dem furchtbaren Gefühl des Ausgeliefertseins.
Allein das Recherchieren und Faktensammeln entfernte meinen Mann und mich von der Warum-Frage und wir konnten den Blick auf den kommenden Weg, auf Andis Therapie richten. Wir konnten beide das Gefühl der Verzweiflung überwinden und hatten dadurch auch wieder Kraft, um zu handeln. Vor allem mein Mann befreite sich von dem quälenden Gedanken, das Problem aussitzen zu müssen und andere über sich bestimmen zu lassen. Der Wechsel nach Freiburg war sein Wunsch und nicht irgendeine Entscheidung eines Chefarztes.
Nach dem ersten lähmenden Schock bedeutet das eine enorme Hilfe. Es kommt eine gewisse Dynamik auf, die der Betroffene selber initiieren kann. Das stärkt. Gleichzeitig wird das Problem nicht einfach weiter ignoriert. Der Albtraum wird realer, was nicht heißt, dass er besser wird. Ein Puzzlestückchen ergänzt das andere. Ob man sich selber auf die Suche nach Informationen begibt oder eine vertrauensvolle Person findet, beispielsweise einen Arzt, Therapeuten oder sonstigen Berater, der für etwas Licht im Dunkel sorgt, ist dabei nicht entscheidend. Ausschlaggebend für Krisenbeteiligte ist allein das kraftgebende Gefühl, eine Bewegung wieder selber auslösen zu können und nicht tatenlos die Katastrophe weiter über sich ergehen lassen zu müssen.
Durch Stehenbleiben vorwärtskommen
„Sie kann es! Andi, seit heute kann sie es wirklich! Unsere Motte ist tatsächlich zum ersten Mal alleine Fahrrad gefahren!“ Ich stehe im Wohnzimmer vor Andis Bild und erzähle mit stolzer Stimme von dem großen Ereignis des heutigen Nachmittags.
Dem Schockzustand nach der Krebsdiagnose konnten sowohl Andi als auch ich relativ zügig entkommen. Ganz anders war es zehn Monate später. Es dauerte sehr lange, bis ich es nach dem Tod meines Mannes geschafft habe, wirklich wahrzunehmen, dass er nicht mehr da ist und dass sich diese Situation auch nicht mehr ändern wird. Eine Zeit des Ausblendens, des Haderns, des Sich-dagegen-Wehrens – eine gewisse Atempause, eben ein Stillstand – waren vorneweg zwingend notwendig gewesen, und diese Zeit habe ich mir unbewusst auch genommen. Es vergingen Wochen, vielleicht auch Monate. Doch mit einem Mal habe ich gemerkt, dass ich ihm trotz allem noch mehr zu sagen hatte als den Satz: „Andi, das geht nicht.“ Ich habe gelernt hinzusehen, denn meine Hast, das Dagegen-Ankämpfen und der verzweifelte Satz, den ich seinem Bild lange Zeit zuflüsterte, halfen mir kein Stück weiter und verbesserten überhaupt nichts. Wirklich gar nichts. Weder meine Ängste vor dem Alleinsein, vor der Verantwortung als Alleinerziehende noch meine Angst vor der Zukunft. Doch diesen Ängsten musste ich mich irgendwann stellen, das hatte ich auf einmal begriffen.
Und deshalb blieb ich eines Tages vor dem Foto stehen und schaute ihn erstmals wieder länger als nur eine Sekunde im Vorbeirennen an. Das war alles andere als leicht. Aber ab dem Moment, als ich ihn wieder richtig ansehen konnte, war es möglich, meine Trauer zuzulassen und mich meinen Ängsten zu stellen. Ich teilte meine Sorgen und die Verzweiflung mit ihm, aber auch die schönen Momente, beispielsweise das Fahrradfahren, auch wenn dabei eine große Traurigkeit mitschwang. Gerne hätte ich es Svenjas Papa überlassen, ihr das Radfahren beizubringen, oder wäre noch lieber zusammen mit ihm aufgeregt und jubelnd hinter dem Fahrrad unserer Tochter hergesprungen.
Ich war also mit einem Mal bereit, stehen zu bleiben, um mich gleichzeitig mit dieser Geste wieder vorwärtszubewegen. Meine Kraft wurde nun anders eingesetzt. Ich hatte Initiative ergriffen und hatte das Gefühl, den Stillstand und das Ignorieren durchbrochen zu haben. Ich war in der grausamen Realität angekommen. Den Albtraum gab es immer noch, doch anders als zuvor sah ich ihm nun in die Augen. Die Bedrohung, die ich bereits am ersten Tag im dunklen Gang der Augenklinik wahrgenommen hatte, war Wirklichkeit geworden. Gleichzeitig barg das Foto meines Mannes eine gewisse Vertrautheit und mit meinen diversen Dialogen brachte ich ihn wieder ein kleines Stückchen zurück in mein Leben. Das stärkte mich, und die Richtung, in die ich blickte, war plötzlich eine andere geworden. Ich hatte mich entschieden hinzusehen, den Schmerz in voller Bandbreite zuzulassen, wieder vorwärtszugehen, wenn ich auch noch überhaupt keine Ahnung hatte, wie dieser Weg ohne ihn aussehen soll.
KAPITEL 2 Der Mann vom TÜV
Wie wichtig es ist, die richtige Sprache zu finden
„Wieso können wir nicht gleich ins Freibad fahren?“ Die Stimme meiner vierjährigen Tochter klingt wenig verständnisvoll für mein heutiges Vorhaben und auch ich kämpfe mit meinem Pflichtgefühl, als ich den wolkenlosen Juli-Himmel über mir betrachte. Doch die blauen Fahnen des TÜV-Gebäudes sind bereits in Sicht. Das Auto fährt ruhig durch die letzte Kurve und ich atme innerlich auf, als ich weder ein ungewöhnliches Quietschen noch ein Klappern vernehme. Wir haben Glück. Bahn 3 ist leer und wir können uns ganz vorne einreihen.
Читать дальше