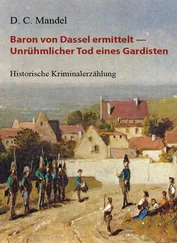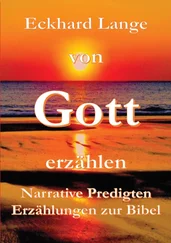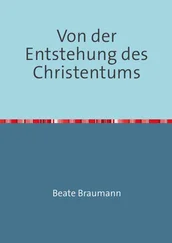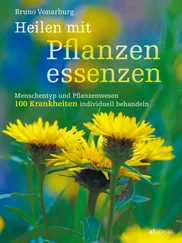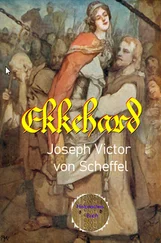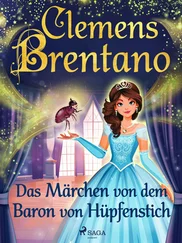5.2.3 Instrumente zur Bekämpfung einer Inflation
5.2.4 Instrumente zur Bekämpfung einer Arbeitslosigkeit
5.2.5 Staatseinnahmen- und Staatsausgabenmultiplikator
5.2.6 Bedeutung und Beurteilung der Staatsverschuldung
5.2.7 Probleme der antizyklischen Fiskalpolitik
6. Der prozesspolitische Rahmen des Unternehmens II: Auswirkungen der Geld- und Kreditpolitik
6.1 Handlungssituation (Fallbeispiel 1)
6.1.1 Geld- und Kreditpolitik als Teilbereich der Wirtschaftspolitik
6.1.2 Institutioneller Rahmen der Geld- und Kreditpolitik
6.1.3 Geld und Geldfunktionen
6.1.4 Erscheinungsformen von Geld
6.1.5 Buchgeldschöpfung
6.1.6 Konvergenzkriterien der EWU
6.1.7 Schuldenfinanzierung durch die EZB
6.1.8 Zielmessung und Zielverwirklichung
6.2 Handlungssituation (Fallbeispiel 2)
6.2.1 Leitzinsen und umlaufende Geldmenge
6.2.2 Schwachstellen der Geld- und Kreditpolitik
6.3 Handlungssituation (Fallbeispiel 3)
6.3.1 Ankauf von Staatsanleihen durch die EZB
6.3.2 Mindestreservepolitik
6.4 Handlungssituation (Fallbeispiel 4)
6.4.1 Unternehmensgewinn und Gewinn der EZB
6.4.2 Beurteilung eines EZB-Gewinns
7. Der strukturpolitische Rahmen des Unternehmens
7.1 Handlungssituation (Fallbeispiel 1)
7.1.1 Strukturpolitik in einer Marktwirtschaft
7.1.2 Ziele der Strukturpolitik
7.2 Handlungssituation (Fallbeispiel 2)
7.2.1 Instrumente der Strukturpolitik
7.2.2 Agrarpolitik als sektorale Strukturpolitik
8. Der internationale Rahmen des Unternehmens
8.1 Handlungssituation (Fallbeispiel 1)
8.1.1 Ursache internationaler Wirtschaftsbeziehungen
8.1.2 Die Zahlungsbilanz
8.1.3 Wechsel-, Devisen- und Sortenkurs
8.2 Handlungssituation (Fallbeispiel 2)
8.2.1 Wechselkurs und Leistungstransaktionen
8.2.2 Wechselkurs und Kapitaltransaktionen
8.2.3 Währungsspekulation
8.2.4 Rückwirkungen des EUR-Wechselkurses
8.3 Handlungssituation (Fallbeispiel 3)
8.3.1 Freie und feste Wechselkurse im Vergleich
8.3.2 Vor- und Nachteile eines EWU-Austritts
9. Gesellschaftlich bedeutsame Entwicklungen und Trends
9.1 Handlungssituation (Fallbeispiel 1)
9.1.1 Demografischer Wandel
9.1.2 Auswirkungen des demografischen Wandels
9.2 Handlungssituation (Fallbeispiel 2)
9.2.1 Technologischer Wandel
9.2.2 Auswirkungen des technologischen Wandels
9.3 Handlungssituation (Fallbeispiel 3)
9.3.1 Tertiarisierung
9.3.2 Auswirkungen der Tertiarisierung
Beispiele von Prüfungsaufgaben mit Lösungsvorschlägen
Stichwortverzeichnis
Der Autor
Weitere Bücher
| BIP |
Bruttoinlandsprodukt |
| CAD |
Kanadischer Dollar |
| CHF |
Schweizer Franken |
| CNY |
Chinesischer Renminbi (Yuan) |
| DKK |
Dänische Krone |
| EU |
Europäische Union |
| EUR |
Euro (€) |
| EWR |
Europäischer Wirtschaftsraum |
| EWS |
Europäisches Währungssystem |
| EWU |
Europäische Währungsunion |
| EWWU |
Europäische Wirtschafts- und Währungsunion |
| EZB |
Europäische Zentralbank |
| GBP |
Pfund Sterling (£) |
| GWB |
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen |
| HVPI |
Harmonisierter Verbraucherpreisindex |
| HWK |
Handwerkskammer |
| HwO |
Handwerksordnung |
| JPY |
Yen |
| NE |
Nationaleinkommen |
| NIP |
Nettoinlandsprodukt |
| NNE |
Nettonationaleinkommen |
| NOK |
Norwegische Krone |
| PE |
Primäreinkommen |
| PLN |
Polnischer Zloty |
| RUB |
Russischer Rubel |
| SEK |
Schwedische Krone |
| SP |
Sozialprodukt |
| USD |
US-Dollar ($) |
| UWG |
Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb |
| VE |
Volkseinkommen |
| VGR |
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung |
| VPI |
Verbraucherpreisindex |
Bedeutung weiterer Abkürzungen im Text.
Kompetenzen und Lernziele
In den folgenden Kapiteln wird dem/r „Geprüften Betriebswirt/in nach der Handwerksordnung“ in Anlehnung an den bundeseinheitlichen Rahmenlehrplan ein volkswirtschaftliches Basiswissen vermittelt, das bei der kompetenten Entwicklung einer Unternehmensstrategie helfen soll. Die zunehmend nationale und auch internationale Vernetzung in Wirtschaft und Gesellschaft zwingen dazu, bei der Entwicklung einer erfolgreichen Unternehmensstrategie verstärkt über den betriebswirtschaftlichen „Tellerrand“ hinauszublicken, volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen in die Überlegungen mit einzubeziehen und mit Blick auf die strategischen Entscheidungen im Unternehmen zu bewerten. Dazu sind Kompetenzen zur Erfassung und Bewertung von volkswirtschaftlichen und politischen Wirkungszusammenhängen und von Innovationen und Trends erforderlich. Die Kurzbezeichnung der konkreten Lerninhalte bzw. Lernziele zum Erwerb dieser Kompetenzen ergibt sich aus den Kapitel- und Abschnittüberschriften.
Textgliederung
Die Vermittlung der Kompetenzen und Lernziele im Text folgt einem klar gegliederten Aufbau, einem „roten Faden“. Er hat folgende Gestalt:
Kapitelüberschrift mit Kurzbezeichnung des Lehr- und Lerninhalts
Handlungssituation (Fallbeispiele 1 ff.)
Beschreibung einer exemplarischen Situation in einem Unternehmen (z. B. in einem konkreten Handwerksbetrieb), aus der sich ein volkswirtschaftlicher Bezug ableiten lässt, entweder als Auswirkungen der betrieblichen Situation auf die volkswirtschaftliche Situationsebene oder als Auswirkungen einer volkswirtschaftlichen Situation auf die betriebliche Situations- und Handlungsebene.
Situationsbezogene Frage (Fragen 1 ff.)
Situationsbezogene Frage mit volkswirtschaftlichem Bezug.
Volkswirtschaftliches Basiswissen – Unterabschnitt mit Kurzbezeichnung
Vermittlung des Basiswissens, das den volkswirtschaftlichen Rahmen der situationsbezogenen Frage abdeckt. Dieser Rahmen ist inhaltlich zwangsläufig weiter gezogen als die auslösende Frage, denn es sollen auch Fragen abgedeckt werden, die sich nicht nur aus der spezifischen, beispielhaften Situation, sondern auch aus ähnlichen Situationen ergeben können.
Situationsbezogene Antwort (Antworten 1 ff.)
Antwort auf die situationsbezogene Frage unter Einsatz des volkswirtschaftlichen Basiswissens.
Situationsbezogene Kontrollaufgabe
In Teilfragen gegliederte Aufgabe, die wiederum ausgehend von einer konkreten betrieblichen Handlungssituation der Überprüfung der im Kapitel erworbenen Wissenskompetenz dient. Antworten auf die entsprechenden Kontrollfragen werden in diesem Lehrbuch im Unterschied zu den situationsbezogenen Fragen bewusst nicht gegeben. Sie sollen erst das Ergebnis der Selbstkontrolle des Lesers im Selbststudium oder im Unterricht sein, ob das erworbene volkswirtschaftliche Basiswissen des betreffenden Teilbereichs praxisnah eingesetzt werden kann. In den Antworten sollte immer auch eine Erläuterung gefordert werden, d. h., das volkswirtschaftliche Basiswissen sollte mit der Aufgabenlösung dokumentiert und eine reine Reproduktion vorgefertigter, möglicherweise auswendig gelernter Antwortschablonen vermieden werden. Beispiele von kapitelübergreifenden Aufgaben mit Lösungsvorschlägen aus der Prüfungspraxis werden am Schluss des Lehrbuches geliefert. Sie sind auch zusammen mit Lösungsvorschlägen für die Kontrollaufgaben in der separat erschienenen Aufgabensammlung zu diesem Lehrbuch enthalten.
Читать дальше